
HAMBURG WASSER
Hamburger Wasserwerke GmbH
Hamburger Stadtentwässerung AöR

Inhalt
Wasser ist eine der wichtigsten und schützenswertesten natürlichen Ressourcen auf unserer Erde. Wir haben in den letzten Jahren vermehrt erfahren können, welche Auswirkungen der Klimawandel haben kann. Zunehmende Extremwetterereignisse sowie die heißen und trockenen Sommer der letzten Jahre beeinflussen unsere Wahrnehmung und prägen auch das Handeln von HAMBURG WASSER. Vor diesem Hintergrund trägt HAMBURG WASSER als kommunaler Trinkwasserver- und Abwasserentsorger große Verantwortung für den Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser. Neben der sicheren Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser und der sicheren Beseitigung anfallenden Abwassers stellt die nachhaltige, dezentrale Regenwasserbewirtschaftung ein wichtiges Unternehmensziel dar. Die rücksichtsvolle Bewirtschaftung und Nutzung der natürlichen Ressourcen ist uns dabei ein Kernanliegen. Als öffentliches Unternehmen ist HAMBURG WASSER hierin eng mit den Interessen der Freien und Hansestadt Hamburg verbunden und steht der Stadt bei ihren Vorhaben zum Schutz der natürlichen Ressourcen und des Klimas als starker Partner zur Seite. Das Unternehmen sieht sich als Innovationstreiber und Partner für eine zukunftsweisende Wasserwirtschaft sowie für Lösungen rund um eine nachhaltige Energieversorgung.
Seit Jahren verfolgt HAMBURG WASSER eigene Konzern- und Unternehmensziele zur stetigen Senkung der CO2-Emissionen und zur Steigerung der Eigenenergieversorgung mit regenerativem Strom. Zur Steigerung des Anteils an eigenerzeugter Energie, hat das Unternehmen 2024 diverse Photovoltaik-Anlagen an eigenen Standorten errichtet. Zur Dekarbonisierung des Standortes Billhorner Deich wurde der Anschluss an ein neu errichtetes Fernwärmenetz veranlasst. Dieses wird aus industrieller Abwärme gespeist, so dass die Treibhausgasemissionen auf ein zu vernachlässigendes Maß reduziert werden können. Darüber hinaus engagiert sich HAMBURG WASSER in Zusammenarbeit mit der Hamburger Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) intensiv für die Integration des Regenwassermanagements in städtische Entwicklungsprozesse, um nachhaltige und klimaresiliente Stadtstrukturen zu fördern.
Die vorliegende Umwelterklärung gibt einen umfassenden Überblick über die Umweltauswirkungen der Tätigkeiten des Unternehmens und belegt diese mit aktuellen Kennzahlen des Jahres 2024. Die Geschäftsführung bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen Mitarbeitenden für ihr Engagement bei der kontinuierlichen Umsetzung unserer Umweltziele und -maßnahmen.
Es ist unser Anspruch, auch in Zukunft den Wasserkreislauf in der Metropolregion Hamburg nachhaltig und mit den besten Lösungen für unsere Kunden, Partner und die Umwelt zu gestalten. Auf diese Weise leisten wir unseren Beitrag für ein lebenswertes Hamburg.
Wir wünschen den Leserinnen und Lesern der Umwelterklärung von HAMBURG WASSER eine interessante und aufschlussreiche Lektüre!
Die Geschäftsführung
Dr. Michael Beckereit Dr. Frank Herzog
Original-Unterschriften liegen vor (eingescannte pdf. Datei)
Hamburg, Mai 2025
HAMBURG WASSER ist ein Gleichordnungskonzern aus den Unternehmen Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) und Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE). HAMBURG WASSER ist Deutschlands zweitgrößtes öffentliches Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen und vereint über 180 Jahre gewachsenes Fachwissen und Kompetenz in Sachen Trinkwasser und Abwasser im Dienst der Menschen und ihrer Stadt (siehe Abbildung 1‑1).
Der Gleichordnungskonzern versorgt rund zwei Millionen Menschen in der Hamburger Metropolregion mit bestem Trinkwasser und reinigt das Abwasser. Mit seinen 23381 Mitarbeitenden ist HAMBURG WASSER ein leistungsfähiges Unternehmen, welches die Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung jederzeit und höchsten Qualitätsansprüchen genügend sicherstellt.
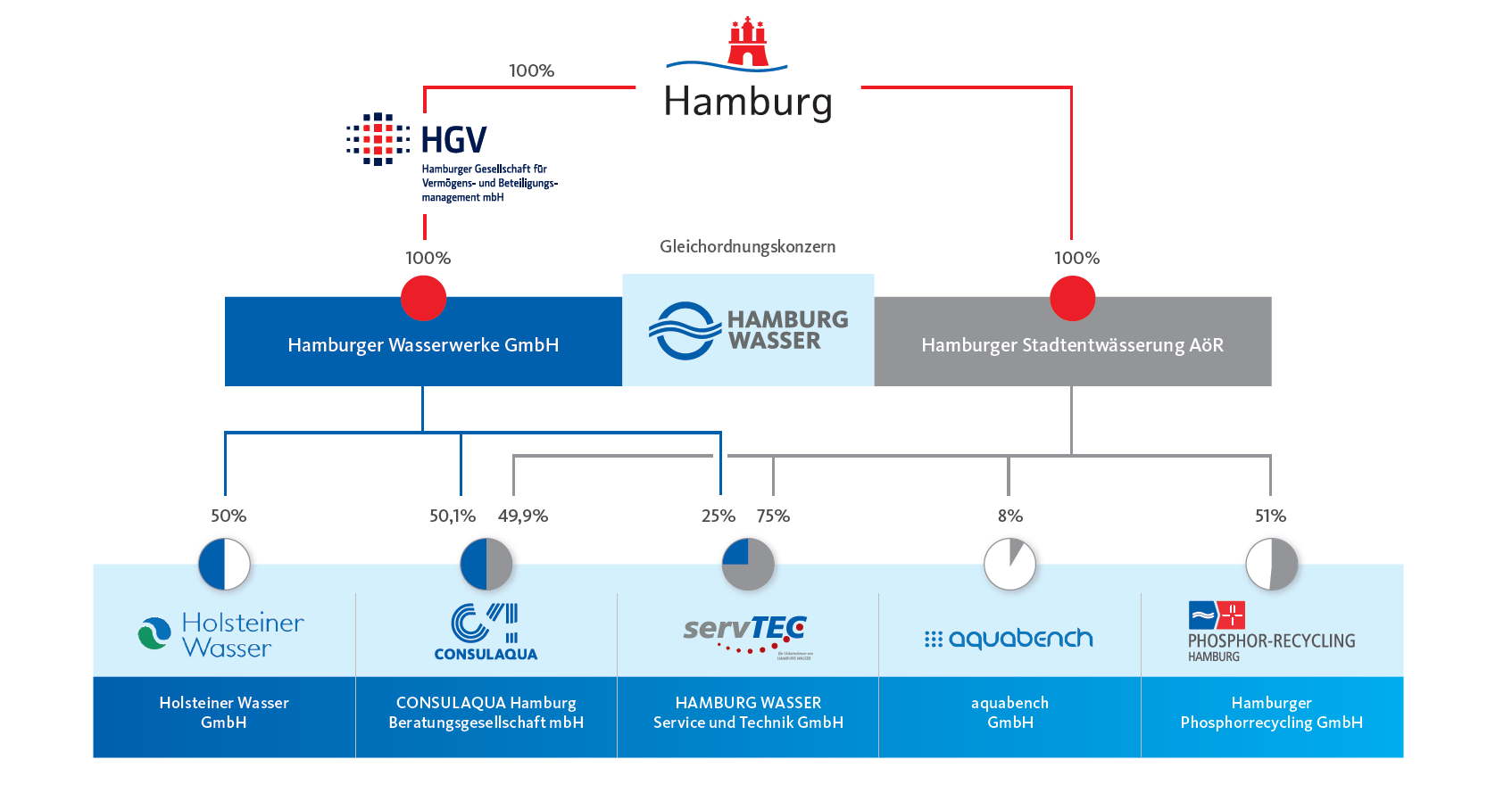
Abbildung 1‑1: Konzernstruktur HAMBURG WASSER (Stand 15. Januar 2024)
Die Unternehmen HWW und HSE werden von einer gemeinsamen Geschäftsführung geleitet. Der Aufbau der Stäbe und der Bereiche ist in beiden Unternehmen identisch. Die organisatorische Struktur von HAMBURG WASSER ist in Abbildung 1‑2 dargestellt. Tabelle 1‑1 fasst die wichtigsten Unternehmenskennzahlen 2024 zusammen.
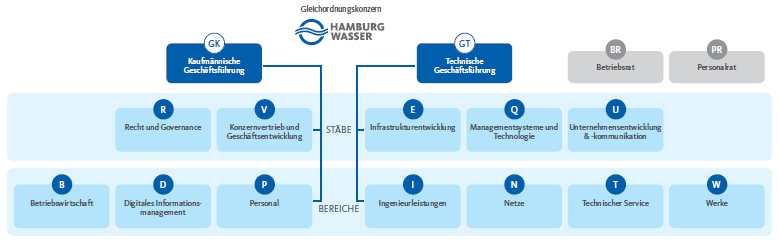
Tabelle 1‑1: Unternehmenskennzahlen 2024
| Unternehmenskennzahlen | Einheit | HWW | HSE |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Mio. € | 324,9 | 388,7 |
| Eigenkapital inkl. Sonderposten | Mio. € | 196,6 | 2.205,2 |
| Anlagevermögen | Mio. € | 701,1 | 3.552,0 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 787,8 | 3.666,0 |
| Cashflow | Mio. € | 61,9 | 158,1 |
| Investitionen | Mio. € | 61,9 | 149,1 |
| Mitarbeitende | - | 1.124 | 1.241 |
Das Umweltmanagementsystem umfasst die Kernprozesse Trinkwasserproduktion, Trinkwasserverteilung, Abwasserableitung, Abwasser- und Schlammbehandlung, Schlammverbrennung sowie den Kundenservice und die zugehörigen Unterstützungs- und Führungsprozesse.
Eine Übersicht der im Umweltmanagementsystem eingeschlossenen Standorte findet sich in Anhang I und II. Pumpwerke und andere technische Anlagen im Stadtgebiet sind den Netzbetriebsstandorten zugeordnet, in deren Einflussbereich sie sich befinden. Einzige Ausnahme ist das zum Klärwerksverbund gehörige Pumpwerk Hafenstraße, das als eigener EMAS-Standort validiert ist.
Das Umweltmanagementsystem gilt nicht für die Tochterfirmen von HAMBURG WASSER. Weiterhin sind außerdem das Wasserwerk Haseldorfer Marsch, welches seit 2008 von der Holsteiner Wasser GmbH betrieben wird, die Standorte der Zweckverbände und Kläranlagen in den Umlandgemeinden, für die HAMBURG WASSER als Dienstleister tätig ist und die Dienstwohnungen, die sich an einigen Standorten befinden, aus dem Geltungsbereich ausgeschlossen. Der Geltungsbereich für HWW und HSE ist näher in Abbildung 1‑3 bzw. Abbildung 1‑4 dargestellt.
Kernaufgabe der Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) ist der Betrieb der öffentlichen Trinkwasserversorgung: Sie versorgt ca. zwei Millionen Kunden in der Freien und Hansestadt Hamburg sowie in über 20 Städten und Umlandgemeinden in Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit Trinkwasser und beliefert außerdem mehrere Gemeinden als Weiterverteiler.
Nachfolgend sind in Abbildung 1‑3 das Versorgungsgebiet in der Metropolregion sowie in Tabelle 1‑2 Betriebskennzahlen der Hamburger Wasserwerke dargestellt. Detaillierte Angaben zu einzelnen Standorten finden Sie in Anhang II dieser Umwelterklärung.
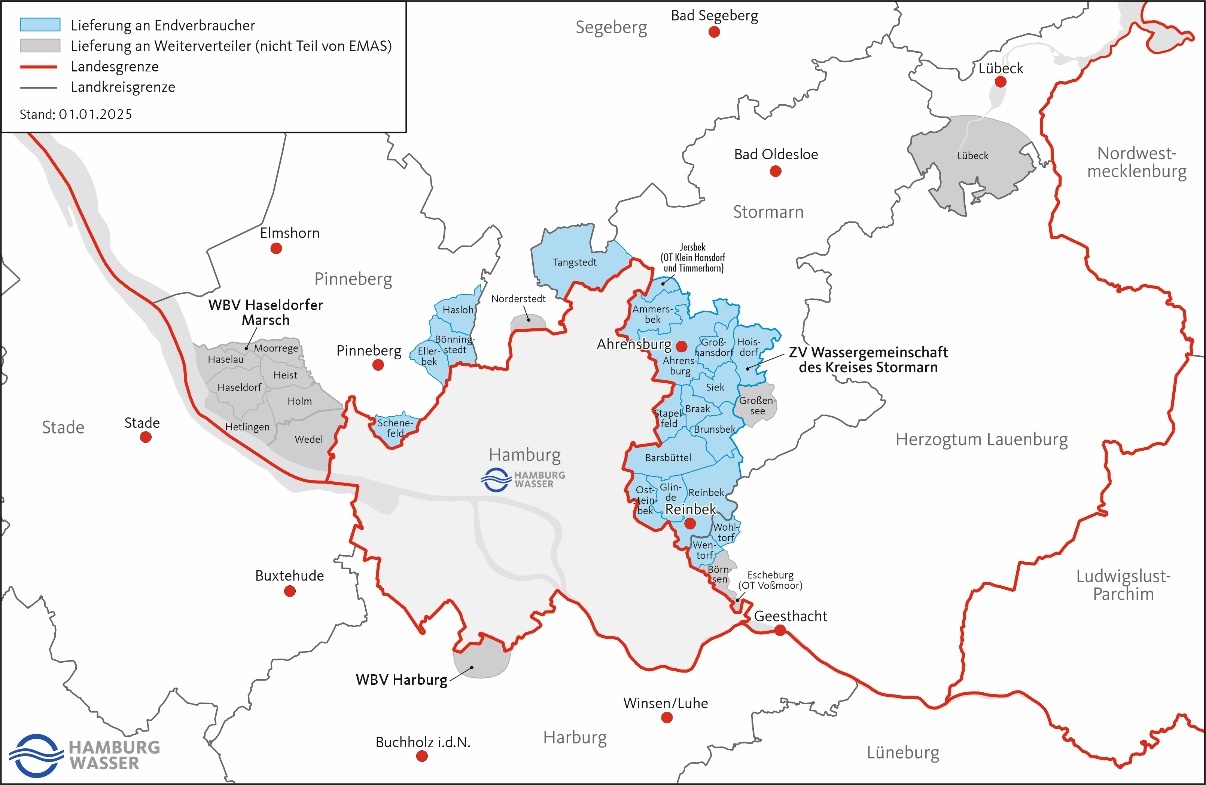
Tabelle 1‑2: Betriebskennzahlen der Hamburger Wasserwerke GmbH
| Betriebszahlen Wasserversorgung |
Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Wasserwerke | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rohrnetzlänge | km | 5.307 | 5.320 | 5.328 | 5.2992 |
| Anzahl Wasserzähler | Mio. - | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,16 |
| Anzahl Wohnungs-, Haus- und Grundstücks-versorgungen | - | 700.821 | 702.803 | 703.780 | 703.602 |
| Einwohner im Versorgungsgebiet | Mio. EW | rd. 2 | rd. 2 | rd. 2 | rd. 2 |
| Verbrauch pro Einwohner und Tag 3 | L/(E∙d) | 115 | 111 | 106 | 107 |
| Rohwasserförderung4 | Mio. m³ | 117,00 | 115,83 | 114,95 | 116,50 |
Kernaufgabe der Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE) ist die hoheitliche Beseitigung des anfallenden Abwassers. Das Hamburger Sielnetz sammelt das Abwasser von ca. zwei Millionen Kunden aus Haushalten sowie Gewerbe- und Industriebetrieben der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) und auch von einer Vielzahl an Städten und Gemeinden im Umland der FHH (sog. Abwasserübernahme) und transportiert es zum Klärwerk Hamburg. Im Klärwerk erfolgt dann die mehrstufige Behandlung des Abwassers sowie die Reststoffverwertung.
Nachfolgend sind in Abbildung 1‑4 die Entsorgungsgebiete in der Metropolregion sowie in Tabelle 1‑3 Betriebskennzahlen der HSE dargestellt. Detaillierte Angaben zu einzelnen Standorten finden Sie in Anhang II dieser Umwelterklärung.
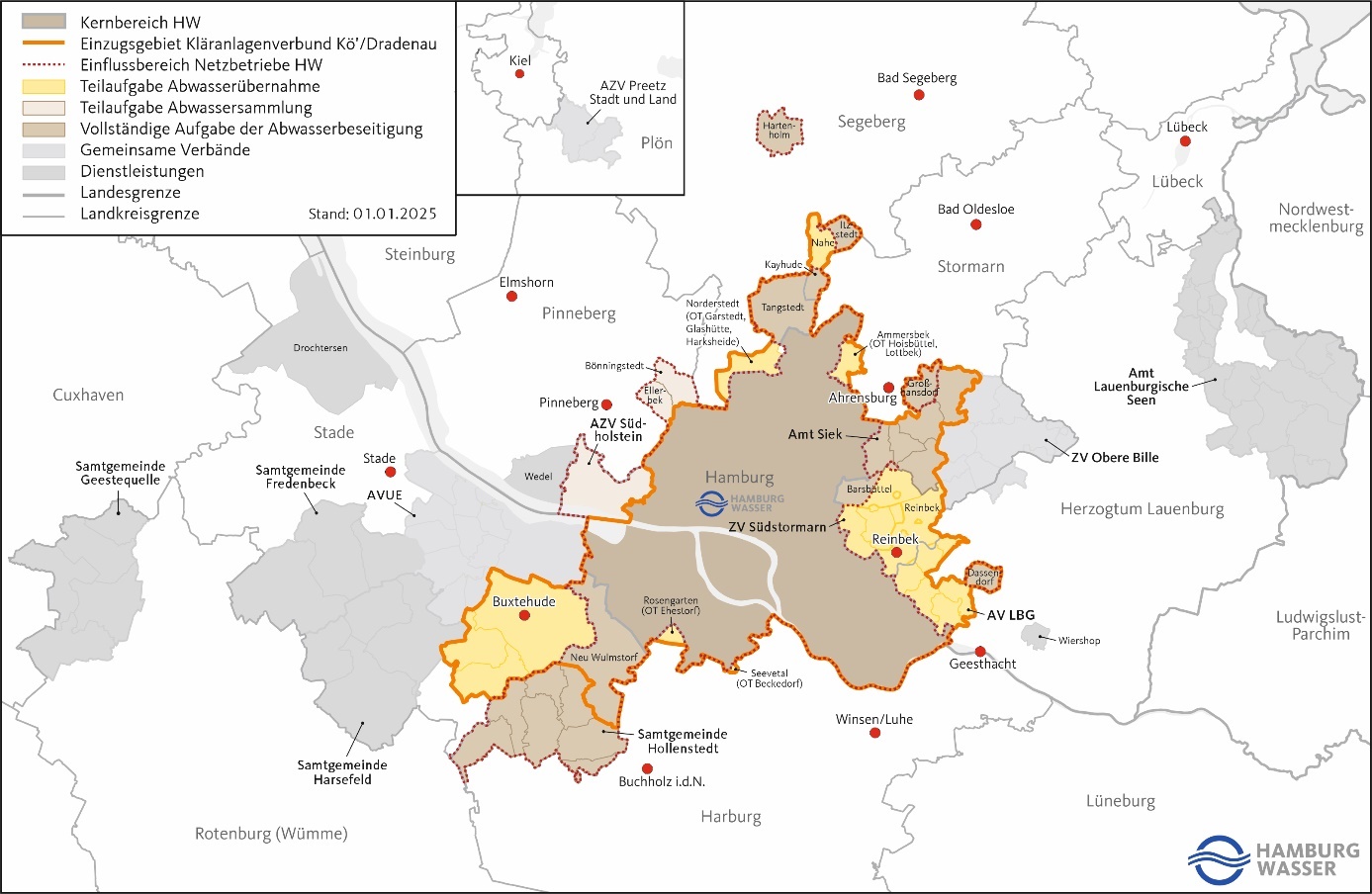
Abbildung 1‑4: Entsorgungsgebiete der Hamburger Stadtentwässerung in der Metropolregion5
Tabelle 1‑3: Betriebszahlen der Hamburger Stadtentwässerung AöR ohne Umlandgemeinden
| Betriebszahlen Abwasserentsorgung |
Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klärwerke | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pumpwerke | - | 399 | 401 | 400 | 408 |
| Sielnetzlänge | km | 6.070 | 6.073 | 6.082 | 6.079 |
| Hausanschlüsse | - | 253.200 | 253.400 | 253.898 | 253.607 |
| Einwohner im Entsorgungsgebiet (Metropolregion HH) | Mio. EW | rd. 2 | rd. 2 | rd. 2 | rd. 2 |
| Schmutzfracht in Einwohnerwerten | Mio. EW | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gebührenrelevante Schmutzwassermenge (Metropolregion HH) | Mio. m³ | 112 | 111 | 111 | 1156 |
| behandelte Abwassermenge auf dem Klärwerk | Mio. m³ | 147 | 153 | 170 | 1837 |
| Teilmenge Übernahmen von außerhamburgischen Gebieten | Mio. m³ | 13 | 14 | 14 | 16 |
| Übergabe an außerhamburgische Gebiete (AZV Südholstein) | Mio. m³ | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Klärschlamm - Menge aus der Abwasserbehandlung | t TS | 35.700 | 36.200 | 33.800 | 37.000 |
| Klärschlamm - Menge verbrannt in der VERA | t TS | 54.869 | 53.700 | 51.930 | 52.7108 |
Die Ziele von HAMBURG WASSER und der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) wurden 2010 in den Zielbildern für HWW und HSE festgeschrieben. Der Auftrag des Unternehmens lautet:
Sichere Versorgung der insbesondere Hamburger Kunden mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser und umweltverträglicher, klimaschonender Energie
Sichere Beseitigung des anfallenden Abwassers und Beförderung einer nachhaltigen, dezentralen Regenwasserbewirtschaftung
Umwelt- und ressourcenschonende sowie nachhaltige Leistungserbringung
Beachtung von Wirtschaftlichkeit bei der Leistungserbringung sowie Erzielung eines angemessenen Ergebnisses und die Gewährleistung langfristig stabiler Gebühren
Service- und kundenorientiertes Management (bei Berücksichtigung des demografischen Wandels, veränderten Nutzerverhaltens und des Klimawandels)
Berücksichtigung der sonstigen öffentlichen Interessen nach Maßgabe des Senats und Orientierung am aktuellen Leitbild der FHH
Basierend auf den Zielvorgaben der FHH wurde 2015 ein Unternehmenskonzept für HAMBURG WASSER erarbeitet, in welchem die Konzern9- und Unternehmensziele bis Ende 2020 festgelegt sind. Unternehmenskonzept und Ziele wurden in einem unternehmensinternen Dialog und Abstimmungsprozess für den Zeitraum 2021 bis 2025 weiterentwickelt und aktualisiert.
Die Managementpolitik von HAMBURG WASSER orientiert sich an den genannten Zielbildern der FHH für die HWW und HSE sowie am Hamburger Corporate Governance Kodex (HCGK). Die Umsetzung aller Anforderungen wird durch das Integrierte Managementsystem unterstützt. Für den Bereich Umwelt ist definiert: „Wir verpflichten uns, unsere Umwelt zu schützen und unsere Umweltleistung stetig zu verbessern. Hierfür haben wir uns insbesondere die Verringerung des Ressourcen- und Energieverbrauchs sowie die weitere Steigerung der Eigenversorgung zum Ziel gesetzt. Die Herausforderung, Umwelteinflüsse, insbesondere Treibhausgas- und Schadstoffemissionen, weiter zu reduzieren gehen wir mit unserem Klimaplan strategisch an. Wir stellen die erforderlichen Mittel zur Umsetzung der Managementpolitik, neuer Ideen und unserer jährlich formulierten Umweltziele zur Verfügung. Die Unternehmensführung von HAMBURG WASSER verpflichtet sich gesetzliche Vorschriften und Normen, interne Richtlinien und Anweisungen sowie allgemeingültige ethischer Grundsätze einzuhalten.”
Die sich daraus ableitenden Ziele sind mit folgenden Kennzahlen definiert:
HAMBURG WASSER reduziert negative Umwelteinflüsse und sucht nach innovativen Ideen zur Beschränkung des Klimawandels und für zusätzliche Herausforderungen der Zukunft,
Senkung der CO2-Emissionen aus dem Wärme- und Kraftstoffverbrauch um weitere 1.300 t CO2
Steigerung der Eigenversorgung mit regenerativem Strom auf 85 %
HAMBURG WASSER wird bei der Zielerreichung durch ein Integriertes Managementsystem (IMS) für Arbeitssicherheit, Qualität und Umweltschutz unterstützt. Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wird dieses stetig weiterentwickelt und an sich ändernde Anforderungen angepasst. Zusätzlich gibt es weitere strategisch bedeutsame Managementsysteme, mit teils eigenständiger Zertifizierung. Im Einzelnen gibt es folgende Managementsysteme bei HAMBURG WASSER:
Umweltmanagementsystem10,11 nach EG-Verordnung Nr. 1221/2009 (EMAS), EMAS-Register-Nr.: DE-131-00045
Arbeitsschutzmanagementsystem
Qualitätsmanagementsystem
Qualitätsmanagementsystem für Labore12 zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC17025:2018, Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-14022-01-00
Informationssicherheitsmanagementsystem: ISO 27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz, Zertifikat Nummer: BSI-IGZ-0531-2023
Datenschutzmanagementsystem
Risikomanagement
Compliancemanagement
Nachhaltigkeitsmanagement
Prozessmanagement
Ideenmanagement
Besondere Aufgaben sind bei HAMBURG WASSER an benannte und beauftragte Personen übertragen worden. Tabelle 2‑1 gibt einen Überblick über Funktionen außerhalb der Aufbauorganisation mit Bezug zum Qualitäts-, Umweltschutz- und Arbeitsschutzmanagementsystem.
Tabelle 2‑1: Beauftragte des IMS bei HAMBURG WASSER (Stand April 2025)
| Funktion und Aufgabe | HWW | HSE | Organisationseinheit |
|---|---|---|---|
| Leiter Stab Managementsysteme und Technologie | x | Q | |
| Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB) | x | Q | |
| Umweltmanagementbeauftragte (UMB) | x | Q | |
| Arbeitsschutzmanagementbeauftragter (AMB) | x | P | |
| Referenten für Compliancemanagement | x | GT 02 | |
| Referenten für Risikomanagement | x | R | |
| Informationssicherheitsbeauftragter | x | GK 02 | |
| Datenschutzbeauftragte | x | GK 02 | |
| Fachkräfte für Arbeitssicherheit (FASi) | x | x | P |
| Gewässerschutzbeauftragte (GwSB) HW | x | x | E / V / N / CAH |
| Gefahrgutbeauftragter nach GbV | x | I | |
| Abfallmanagementbeauftragte HW | x | x | I |
| Entsorgungsmanagement | x | x | B |
| Standortbeauftragte für Abfall | x | x | N, W, T |
| Abfallbeauftragter Klärwerk Hamburg | x | W | |
| Immissionsschutzbeauftragte | x | W | |
Qualitäts- und Umweltkoordinatoren (QU-Ko) Sicherheitsbeauftragte (SiB) Arbeitssicherheitskoordinatoren (ASiKo) Datenschutzkoordinatoren |
Bena nnte V ertr eter in j edem Ber eich | ||
| Betriebsärzte | x | x | P |
| Gesundheitsmanagement | x | P |
Das Umweltmanagement ist zentraler Bestandteil des IMS. HAMBURG WASSER ist seit 2008 durchgängig entsprechend der Vorgaben der EG-Verordnung Nr. 1221/2009 in der jeweils aktuellen Fassung, d. h. des Eco Management and Audit Scheme (EMAS) validiert. EMAS wurde von der Europäischen Union für Organisationen entwickelt, die ihre Umweltleistung verbessern wollen. Integrale Bestandteile sind die hier vorgelegte Umwelterklärung, die regelmäßige Begehung von Standorten im Rahmen sogenannter Umweltbetriebsprüfungen, die jährliche Fortschreibung des Umweltprogramms, vgl. Kapitel 4, und die regelmäßige Überprüfung der Umweltauswirkungen und Umweltaspekte, vgl. Kapitel 3.
Anforderungen an HAMBURG WASSER ergeben sich aus freiwilligen Selbstverpflichtungen, rechtlichen Verpflichtungen sowie Kundenanforderungen. Die Überwachung von Rechtsvorschriften und Regelwerken ist für das Unternehmen HAMBURG WASSER in einer Verfahrensanweisung geregelt. Die für HW im Umweltbereich geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, EU-Vorschriften etc. sind in dem Verzeichnis der Rechtsvorschriften (VdR) geführt. Das VdR wird durch die darin benannten Monitore kontinuierlich aktualisiert. Die Verantwortung für die Organisation der systematischen Beobachtung und Aktualisierung relevanter Rechtsvorschriften und Regelwerke sowie deren Einhaltung tragen bei HAMBURG WASSER die Abteilungsleitungen. Das Compliancemanagement übernimmt die Überwachung der regelmäßigen Aktualisierung des Verzeichnisses der Rechtsvorschriften.
Die wichtigsten bindenden rechtlichen Verpflichtungen im Umweltschutz ergeben sich für HAMBURG WASSER in den folgenden Sachgebieten:
Gewässerschutz (Wasser, Abwasser)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Abwasserverordnung (AbwV)
Abfall- und Kreislaufwirtschaft (inkl. Klärschlamm)
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)
Immissionsschutz
Klimaschutz
Energierecht
Boden- und Naturschutz
Gefahrstoffe, Chemikalien und wassergefährdende Stoffe
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
Gefahrgut
Umweltmanagement
DIN EN ISO 14001:2015
EMAS-III-Verordnung
Das Monitoring der Besten Verfügbaren Techniken (BVT) Merkblätter und Schlussfolgerungen erfolgt durch die Immissionsschutzbeauftragte. Mit der Veröffentlichung am 03.12.2019 betreffen die BVT-Schlussfolgerungen für Abfallverbrennungsanlagen die VERA. Diese wurde im Februar 2024 mit der Novelle der 17. BImSchV größtenteils in nationales Recht umgesetzt. Die Aktualisierung der Anforderungen in Bezug auf die Abwasserbehandlung von Verbrennungsanlagen wird in Kürze erfolgen (Abwasserverordnung Anhang 33).
Die Einhaltung umweltschutzrechtlicher Vorgaben wird durch die Umweltmanagementbeauftragte sowie weitere Beauftragte (z. B. Immissionsschutzbeauftragte, Gewässerschutzbeauftragte, Gefahrgutbeauftragter, Abfallbeauftragter Klärwerk) an den Standorten in Audits, Umweltbetriebsprüfungen und Begehungen stichprobenartig überprüft. Das Compliance-Management führte 2022 im Rahmen der Compliance-Risikoanalyse eine Bewertung der Umweltrisiken durch.
Die Umsetzung von in den Umweltbetriebsprüfungen festgestellten Verbesserungspotentialen wird über das Verzeichnis der Maßnahmen (VdM) nachverfolgt und dokumentiert. 2024 wurden 5 Abweichungen und 49 Verbesserungspotentiale ausgesprochen und in das VdM übernommen. Erkannte Schwächen wurden in die Bereiche kommuniziert, sodass eine Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen an allen Standorten erfolgen kann. Die Umsetzung der Maßnahmen wird über das VdM regelmäßig nachverfolgt.
Zusätzlich berichten die Betriebsbeauftragten jährlich der Geschäftsführung bzw. dem Standortverantwortlichen für das Klärwerk. In diesen Berichten wird unter anderem die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen bewertet und dokumentiert.
Immissionsschutz: Im Jahr 2024 gab es 28 Grenzwertüberschreitungen in der kontinuierlichen Überwachung der Verbrennungslinien und zwei bei der Gasturbine/Abhitzekessel. Beim Gasmotor wurde keine Überschreitung festgestellt. Bei der Auswertung der Ursachen für die Überschreitungen fiel auf, dass es sich bei 14 um Schwierigkeiten und ungewöhnliche Zustände bei Wiederanfahren nach Außerbetriebnahmen oder Stromausfall handelt. Dabei war auch der unterschiedliche Feuchtegehalt des Klärschlamms aus der Klärschlammtrocknung ein Faktor, der einen stabilen Verbrennungsbetrieb erschwerte. Die anderen Fälle waren durch technische Defekte oder Fahrweisen bei TÜV-Prüfungen bedingt. Alle Überschreitungen wurden vorschriftsmäßig gegenüber der Behörde angezeigt.
Abfall: Im Jahr 2024 wurde die VERA-Klärschlammverbrennungsanlage erneut erfolgreich zertifiziert. Die Anlage erfüllt sämtliche organisatorische, personelle, inhaltliche und verfahrensmäßige Anforderungen gemäß der Entsorgungsfachbetriebsverordnung und darf weiterhin den Titel "Entsorgungsfachbetrieb" tragen.
Um den stetig wachsenden Anforderungen des Kreislauf- und Abfallrechts im laufenden Betrieb bei HAMBURG WASSER gerecht zu werden, wurde im Oktober 2021 eine neue Stelle für das Abfallmanagement geschaffen. Im Rahmen dieses Projekts wurde das HW-weite Abfallmanagement initiiert und befindet sich derzeit in den letzten Phasen der Umsetzung. Seit Juli 2023 ist eine Abfallmanagementbeauftragte für HWW und HSE benannt. Zur weiteren Optimierung und Anpassung an die aktuellen Entwicklungen wurde die Abfallaufbauorganisation durch die Benennung der Standortbeauftragten für Abfall vorgenommen.
Gefahrgut: Im Bereich Gefahrgut wurden 2024 keine Verstöße gegen rechtliche Verpflichtungen oder behördliche Genehmigungsauflagen von den Betriebsbeauftragten festgestellt.
Gewässerschutz: In der behördlichen Überwachung und in der Eigenüberwachung hat es im Jahr 2024 keine Überschreitungen gegeben.
In den Jahresberichten der Gewässerschutzbeauftragten sind im Geltungsbereich von EMAS drei Betriebsstörungen mit Abwasseraustritt dokumentiert. Erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung solcher Störungen wurden durch die zuständigen Netzbetriebe zeitnah ergriffen und die zuständigen unteren Wasserbehörden bei Bedarf informiert, um den erforderlichen Umbau zu initiieren.
Im Rahmen der Eigenüberwachung der wasserrechtlichen Erlaubnisse für Sonderauslässe wurde im Jahr 2024 eine Entlastungsmenge13 von insgesamt 1.2 Mio. m³ verdünntem Mischwasser bei starken Niederschlagsereignissen festgestellt und im Rahmen eines Jahresberichts an die Behörde gemeldet.
Im Zuge planmäßiger Nebelung13 der Schmutzwasserkanalisation werden fortlaufend Regenwasserfehlanschlüsse festgestellt und Grundstückseigentümer aufgefordert, diese zurückzubauen. Weiterhin wurden 7 Fehlanschlüsse festgestellt, bei denen Schmutzwasser in ein Regensiel eingeleitet wurde. Die Behebung wurde umgehend angeordnet.
Die unternehmerischen Tätigkeiten und Dienstleistungen von HAMBURG WASSER haben in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Auswirkungen auf die Umwelt. Die Tätigkeiten und Dienstleistungen, welche Auswirkungen auf die Umwelt haben, werden als Umweltaspekte bezeichnet. Für HAMBURG WASSER ist es von zentraler Bedeutung, seine Umweltaspekte zu kennen, um die Auswirkungen auf die Umwelt verbessern zu können.
HAMBURG WASSER bewertet seine Umweltaspekte und die damit verbundenen Umweltauswirkungen alle drei Jahre. Die letzte Überprüfung fand in Form eines abteilungsübergreifenden Workshops im Januar 2023 statt. Das methodische Vorgehen kann im Detail der Umwelterklärung 2022 entnommen werden. Die wesentlichen Umweltaspekte bilden die Grundlage für die Formulierung der Umweltziele, die jährlich im Rahmen des Umweltprogramms (Kapitel 4) veröffentlicht werden.
Die wesentlichen Umweltaspekte14 von HAMBURG WASSER lassen sich in die folgenden, in Abbildung 3‑1 vollständig ausgeführten Gruppen, zusammenfassen.
Wasser, Boden & Biodiversität
Energie
Emissionen
Beschaffung & Ressourcenverbrauch
Entsorgung & Recycling
Kommunikation & Öffentlichkeit
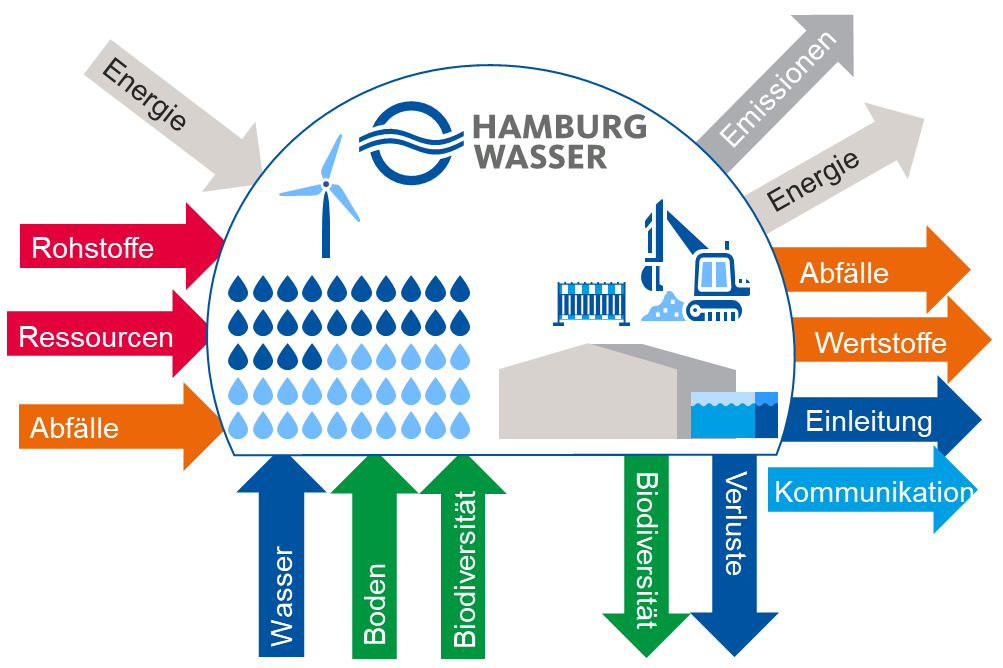
Abbildung 3‑1: Umweltaspekte und -auswirkungen von HAMBURG WASSER
Grundlage und Kern des Handelns von HAMBURG WASSER ist: Sauberes
Trinkwasser. Der Erhalt einer sauberen Umwelt ist dabei unverzichtbar.
Viele der wesentlichen Umweltaspekte von HAMBURG WASSER ergeben sich
entlang des Lebensweges des Wassers und Abwassers (Abbildung 3‑2). Beim
Lebensweg eines Produktes werden hintereinander verschiedene Phasen
durchlaufen. Die Phasen des Lebensweges des Hauptprodukts Wasser können
auf den Kreislauf des Wassers und die damit verbundenen
unternehmerischen Tätigkeiten von HAMBURG WASSER angewendet werden.
Abbildung 3‑2: Der Lebensweg des Wassers anhand der Phasen bei HW an
der Schnittstelle zum natürlichen Wasserkreislauf
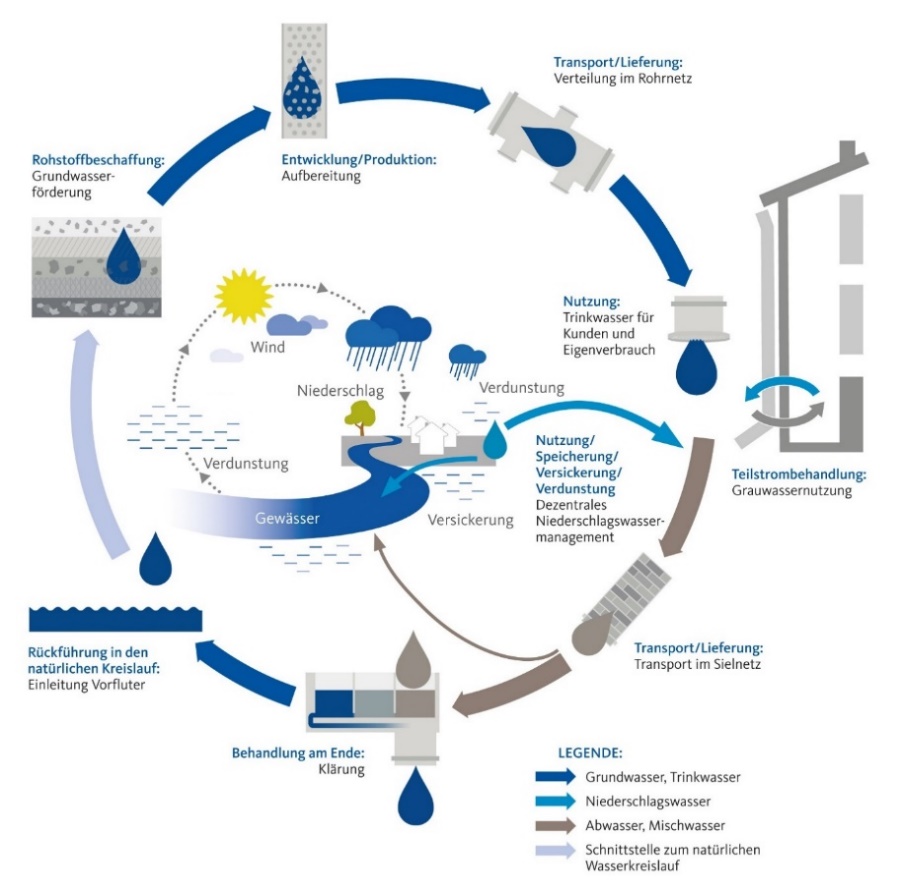
Der Lebenszyklus ist dabei vollständig geschlossen und wird zwischen den Phasen der Einleitung des geklärten Abwassers in den Vorfluter und der Rohstoffbeschaffung (Grundwasserförderung) durch den natürlichen Wasserkreislauf bestimmt. In dieser Phase haben die unternehmerischen Tätigkeiten von HAMBURG WASSER keinen direkten Einfluss auf die Wasserressourcen. Aufgrund seiner verstärkten Aktivitäten bei der dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung setzt sich HAMBURG WASSER indirekt dafür ein, das Grundwasserdargebot zu erhalten. Weiterhin werden Konzepte für die Wiederverwendung von Teilströmen wie Niederschlagswasser und Grauwasser entwickelt und u. a. mit dem HAMBURG WATER Cycle® umgesetzt.
Die Versorgung mit Trinkwasser ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und verdient unter allen Nutzungsarten des Wassers unbedingt Vorrang. Die öffentliche Trinkwasserversorgung Hamburgs beruht ausschließlich auf der Grundwassergewinnung. Eine leistungsfähige Wasserversorgung garantiert eine einwandfreie Trinkwasserqualität und trägt entscheidend zur Lebensqualität der Bevölkerung bei. Die Trinkwasserqualität wird durch das Einhalten von strengen Qualitätsnormen, die in Deutschland in der Trinkwasserverordnung festgelegt sind, gesichert. Zusätzlich wird sich auch nach DVGW-Empfehlungen gerichtet, welche teilweise strengere Vorgaben machen. Das Kriterium eines lebenslangen menschlichen Genusses ohne negative Auswirkungen auf die Gesundheit stellt eine Grundlage für die darin definierten Grenzwerte dar. Dem Minimierungsgebot folgend, werden die Grenzwerte in der Regel deutlich unterschritten. Zur Überwachung der Aufbereitung werden in den Wasserwerken täglich Wasserproben entnommen und analysiert. Die Untersuchungen umfassen physikalische, chemische und mikrobiologische Parameter. 2024 hat das Trinkwasserlabor von HAMBURG WASSER insgesamt die in Tabelle 3‑1 dargestellte Anzahl an Laboruntersuchungen durchgeführt.
Tabelle 3‑1: Laboruntersuchungen des Trinkwasserlabors im Jahr 2024
| Analytik | Einheit | Mikrobiologie | Chemie |
|---|---|---|---|
| Probenzahl | Anzahl | 32.583 | 35.880 |
| Parameter | Anzahl | 167.972 | 710.589 |
HAMBURG WASSER stellt der Öffentlichkeit für jedes Wasserwerk umfassende Analysen des abgegebenen Trinkwassers bereit.15 Abbildung 3‑3 zeigt die Trinkwasserabgabe in das Rohrnetz von HAMBURG WASSER in Form eines Sankey-Diagramms. Die Rohwasserförderung der Wasserwerke betrug 2024 rund 116,5 Mio. m³.
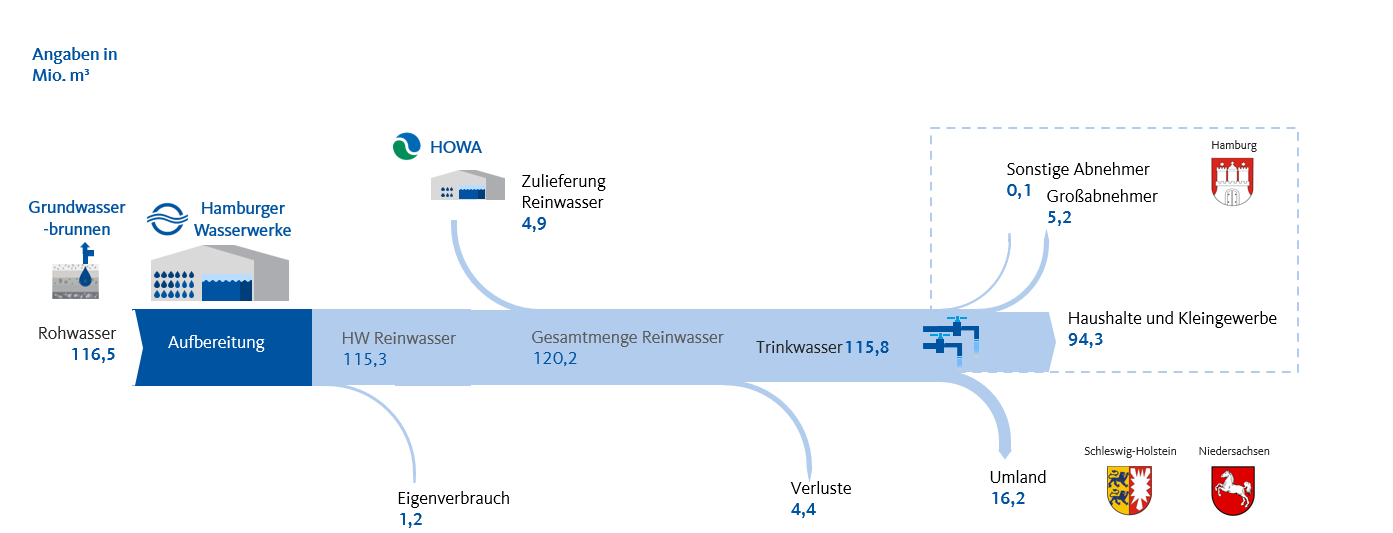
Abbildung 3‑3: Sankey-Diagramm von der Rohwassergewinnung zur Wasserabgabe in Mio. m³
Ein zentrales Bewirtschaftungskriterium für HAMBURG WASSER stellt die Nachhaltigkeit dar. Eine nachhaltige Wassergewinnung bedeutet, dass die Ressource Grundwasser nicht durch eine Übernutzung gefährdet werden darf. Letztere würde sich in langanhaltenden abnehmenden Trends der Grundwasserstände ausdrücken. Zur Überwachung des qualitativen und quantitativen Zustandes des Grundwassers betreibt HAMBURG WASSER ein umfangreiches Monitoringmessnetz. Dieses geht in der Regel über die wasserrechtlichen Anforderungen hinaus. Seit 2022 wird ein eigenständiger Bericht16 veröffentlicht, der auf das zurückliegende hydrologische Jahr blickt und die Verantwortung für die kostbare Ressource Süßwasser thematisiert. Im letzten hydrologischen Jahr (November 2023 – Oktober 2024) führten die reichhaltigen Niederschläge zu einer deutlichen Zunahme der Bodenfeuchte. Dies führte zu einer Erholung der Grundwasserstände in und um Hamburg.
Die Ergebnisse des Monitorings sind Grundlage der regelmäßigen Überprüfung des Grundwasserdargebots. Aktuell beträgt das für HAMBURG WASSER nutzbare Grundwasserdargebot insgesamt 129,51 Mio. m³ pro Jahr. Das Trinkwasser für Hamburg wird aus Grundwasserressourcen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gewonnen. 2024 betrug die gesamte Grundwasserentnahmemenge 123,1 Mio. m³ 17, wovon mit 76,2 Mio. m³ die größte Menge in Hamburg gefördert wurde. In Schleswig-Holstein wurden 31,3 Mio. m³ und in Niedersachsen wurde mit 15,6 Mio. m³ die geringste Menge entnommen. Die Wasserrechte für Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein betragen insgesamt 139,31 Mio. m³.
Für die Zukunft geht HAMBURG WASSER von steigenden Trinkwasserbedarfen in Hamburg aus. Gründe dafür sind das anhaltende Wachstum der Bevölkerung sowie mögliche Folgen des Klimawandels: Hitze- und Trockenphasen führen zu steigender Nachfrage, insbesondere im Hochsommer. Um auch künftig eine verlässliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können, investiert HAMBURG WASSER in die Erweiterung der Gewinnungs- und Aufbereitungskapazitäten. Dies umfasst u. a. die Erkundung und Erschließung weiterer Grundwasserressourcen, die Auslotung des verfügbaren Dargebotes für die Bestandsfassungen und die Nutzung von Prozesswasser-Recycling in den Wasserwerken.
Ein weiterer Hebel zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser ist der individuelle Verbrauch der Kunden. Hamburg hat eine lange Tradition, was das Wassersparen angeht. Seit den 1970er Jahren sind die Pro-Kopf-Verbräuche aufgrund von stetigen Sparbemühungen und Modernisierungen im Haushalt zurückgegangen. Große Erfolge wurden u.a. durch die flächendeckende Einführung von Wohnungswasserzählern, die Hamburg als erste deutsche Großstadt auf den Weg gebracht hat, erreicht. Seit den 2010er Jahren wies der Pro-Kopf-Verbrauch allerdings wieder eine leicht ansteigende Tendenz auf. Das Bevölkerungswachstum hat den Anstieg der Gesamtverbräuche darüber hinaus verstärkt. Der öffentliche Appell von HAMBURG WASSER, verantwortungsbewusst mit der Ressource umzugehen und insbesondere im Hochsommer Wasser zu sparen, hat Wirkung gezeigt. Im Vergleich zu 2021 (115 l/Einwohner) ist der tägliche Trinkwasserverbrauch pro Kopf gesunken (2024: 107 l/Einwohner).
Wasser in Trink- bzw. Brauchwasserqualität wird in allen Betriebsbereichen von HAMBURG WASSER genutzt. Bei der Trinkwasserverteilung kommen Wasserverluste im Rohrnetz hinzu. 2024 betrug der Wassereigenverbrauch des gesamten Unternehmens rd. 2,91 Mio. m³ und entsprach damit den Mengen aus dem Vorjahr (2023: 2,91 Mio. m³). Der Eigenverbrauch der Wasserwerke lag bei ca.1,2 Mio. m³.
Bei den Wasserwerken wird Trinkwasser fast ausschließlich für die Rückspülung von Filtern eingesetzt. Der Spülwasserverbrauch der Wasserwerke lag 2024 bei rd. 1,4 Mio. m³. Aus diesem Grund strebt HAMBURG WASSER eine Reduktion des Eigenverbrauchs durch die Wiederverwendung von Filterspülwässern (Spülwasserrecycling) an, um die Trinkwasserverfügbarkeit weiter zu erhöhen. Hierzu arbeitet HAMBURG WASSER an dem Projekt „FITWAS – Spülwasserrecycling”.
Im Rohrnetz wird Trinkwasser vor allem für Leitungsspülungen im Rahmen von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Zum einen wird dadurch der hygienisch einwandfreie Betrieb nach Baumaßnahmen gewährleistet, zum anderen wird das Rohrnetz im Zuge von Unterhaltungsmaßnahmen von Ablagerungen der natürlichen Wasserinhaltstoffe Eisen und Mangan befreit. 2024 wurden für Spülungen im Trinkwasserrohrnetz insgesamt 27032 m³ Wasser eingesetzt.
Beim Transport des Trinkwassers von den Wasserwerken zum Kunden kann Wasser durch Undichtheiten und Rohrbrüche im Rohrnetz verloren gehen. Die Wasserverluste im Rohrnetz in Hamburg sind im Vergleich zum Bundesdurchschnitt sehr gering. Für 2024 wurde aus der Wassermengenbilanz ein Gesamtverlust von 4,3 Mio. m³/a ermittelt, was einem gemittelten Wasserverlust18 von 3,6% entspricht.
Wasser wird zur Reinigung der Siele eingesetzt. Um den Wasserverbrauch bei der Abwasserableitung möglichst niedrig zu halten, werden bei der Kanalreinigung fast ausschließlich Reinigungsfahrzeuge mit modernster Wasserrückgewinnungstechnologie eingesetzt.
Der Gesamtwasserbedarf der Klärwerksstandorte für die Abwasserbehandlung wurde 2024 zu 93% aus Brauchwasser gedeckt. Dieses Brauchwasser wird zum Beispiel als Spülwasser, in Siebanlagen und Sandwaschanlagen eingesetzt. Der Brauch- und Kühlwassereinsatz aus 2024 an den Klärwerksstandorten ist in Tabelle 3‑2 im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt. Der Brauch- und Kühlwassereinsatz lag mit 16,5 % unterhalb der genehmigten Fördermenge von 800.000 m³. Das Klärwerk betreibt eine eigene Grundwasseraufbereitungsanlage.
Tabelle 3‑2: Brauch- und Kühlwassereinsatz an den Klärwerksstandorten
| Brauch- und Kühlwassereinsatz | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brauchwasser Standort Köhlbrandhöft | m³ | 491.700 | 493.690 | 493.690 | 319.271 |
| Kühlwasser Standort Köhlbrandhöft | m³ | 225.000 | 218.260 | 218.260 | 395.835 |
| Brauchwasser Standort Dradenau | m³ | 6.560 | 6.860 | 9.040 | 8.510 |
Mit Trinkwasser wird an allen Standorten des Klärwerks sparsam umgegangen. Es wird nur verwendet, wenn kein Brauchwasser eingesetzt werden kann oder dieses nicht verfügbar ist. 2024 wurden für den verbleibenden Wasserbedarf der Abwasser- und Klärschlammbehandlung insgesamt ca. 27444 m³ Trinkwasser verbraucht. Für die Dampfproduktion der VERA wurden weitere 30230 m³ Trinkwasser eingesetzt. Eine Übersicht des Trinkwassereinsatzes an den Klärwerkstandorten der letzten Jahre wird in Tabelle 3‑3 gegeben.
Tabelle 3‑3: Trinkwassereinsatz an den Klärwerksstandorten
| Trinkwassereinsatz je Standort | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standort Köhlbrandhöft | m³ | 23.490 | 39.960 | 30.410 | 25.650 |
| Dampfproduktion VERA | m³ | 27.040 | 27.200 | 22.790 | 31.072 |
| Standort Dradenau | m³ | 1.753 | 2.083 | 2.119 | 1.652 |
| Pumpwerk Hafenstraße | m³ | 2.922 | 191 | 194 | 142 |
Die Veränderungen im Trink- und Brauchwasserverbrauch sind mit der Durchführung von Baumaßnahmen, prozesstechnisch und klimatisch zu begründen.
Das im Klärwerk Hamburg gereinigte Abwasser wird in den Köhlbrand, einen Mündungsarm der Süderelbe, eingeleitet. 2024 wurden 183,4 Mio. m³ gereinigtes Abwasser eingeleitet. Die Menge des gereinigten Abwassers hat im Vergleich zum Vorjahr (2023: 169,8 Mio. m³) um 14,5 Mio. m³ zugenommen.
Das Klärwerk Hamburg ist auf dem Stand der Technik und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen, was die Reinigungsleistung angeht. Alle Auflagen der wasserrechtlichen Erlaubnis wurden 2024 eingehalten.
Vom Klärwerk wird dabei jährlich weniger Schmutzfracht eingeleitet, als nach wasserrechtlicher Erlaubnis gestattet wäre. Dies wird durch ständige Optimierung und Anpassung der Verfahrensschritte erreicht. In vielen Fällen übertrifft die Reinigungsleistung des Klärwerks sogar die gesetzlichen Vorgaben. Die im Abwasser enthaltenen organischen und anorganischen Schadstoffe werden somit deutlich reduziert. Die Zulauffrachten und Reinigungsleistung des Klärwerks bezogen auf den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB), Stickstoff und Phosphor sind in Abbildung 3‑4 und Abbildung 3‑5 dargestellt. Nachdem die Zulauffrachten bis etwa 2020/21 rückläufig waren, wurde zuletzt wieder eine Zunahme beobachtet. Einflussfaktoren für die Zunahme der Zulauffrachten können die Aufhebung der Coronamaßnahmen und die Zunahme der Bevölkerung von Hamburg sein.
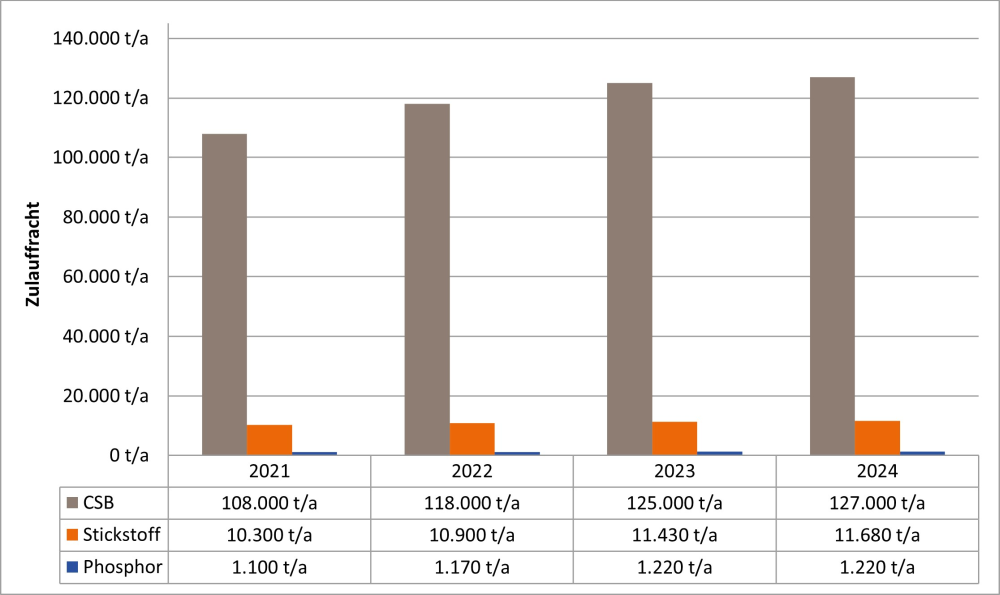
Abbildung 3‑4: Entwicklung der Schmutzfrachten im Zulauf des Klärwerksverbundes im Vergleich der letzten vier Jahre
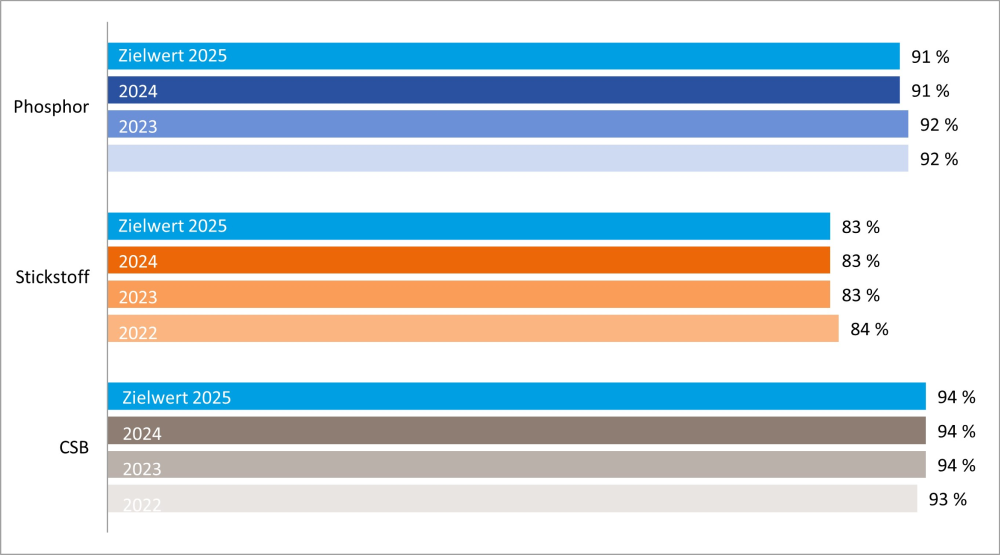
Abbildung 3‑5: Reinigungsleistung des Klärwerks Hamburg bezogen auf Phosphor, Stickstoff und chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) für die letzten drei Jahre und Zielwerte für 2025
Bei der Abwasserreinigung werden auch viele Schadstoffe (z. B. Industriechemikalien, Medikamentenrückstände oder Mikroplastik) in der Abwasserbehandlung von der flüssigen Phase separiert, im Klärschlamm aufkonzentriert und anschließend in der Klärschlammverbrennungsanlage unschädlich gemacht. Allerdings sind Kläranlagen in der Regel nicht darauf ausgelegt, solche Stoffe zu 100 Prozent zu beseitigen. Deshalb verbleiben Schadstoffe im Wasser und finden über den Kläranlagenablauf den Weg ins Gewässer. Hamburg ist hier keine Ausnahme.
Der einfachste, kostengünstigste und effektivste Weg zu sauberem Wasser ist eine Reduzierung der Verunreinigung beim Gebrauch des Wassers. Der Schutz unserer Gewässer ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Damit Schadstoffe erst gar nicht ins Abwasser gelangen, muss an der Quelle der Verursacher angesetzt werden. Ziel sollte ein gelebtes Verursacherprinzip und offene Dialoge mit allen Beteiligten sein.
Die durch den Klimawandel zunehmenden Starkregenereignisse können die zu bewältigende Abwassermenge gegenüber der Menge bei Trockenwetter kurzzeitig um mehr als das 20-fache steigern. Solche Starkregenereignisse können dazu führen, dass die Aufnahmekapazität des Abwassernetzes erschöpft ist und es durch Überlastung der Siele zu Überläufen in die Elbe, Alster und Bille sowie deren Nebengewässer kommen kann. Zum Schutz der Gewässer sind diese Überlaufereignisse so weit wie möglich zu minimieren. Daher wurde bereits seit den 1970er Jahren zusätzliches Rückhaltevolumen zur Zwischenspeicherung von Mischwasser geschaffen. Transportsiele und Sammler, auch „Abwasserautobahnen” genannt, entlasten die Kanalisation zusätzlich, da sie ohne Anschluss an die Oberflächengewässer direkt zum Klärwerk Hamburg führen.
Können Mischwassermengen nicht zum Klärwerk weiterfließen oder in Rückhaltebecken im Netz gespeichert werden, werden sie über die Regen-Entlastungssiele und Auslässe in die Gewässer abgeleitet. Wären diese nicht vorhanden, könnte sich das Kanalnetz nur noch unkontrolliert über die Schachtdeckel in die Straßen und Keller entlasten. Zudem gibt es bei einigen Pumpwerken Notauslässe, die im Falle eines Störfalles des Pumpwerks den unkontrollierten Austritt von Schmutz- und Mischwasser verhindern.
Im jährlichen Eigenüberwachungsbericht an die Aufsichtsbehörde berichtet HAMBURG WASSER über Menge und Anzahl der Mischwasserüberläufe. Von den insgesamt 131 Mischwasserüberläufen sind 2024 111 Stück angesprungen. Dabei wurden insgesamt rund 1.17 Mio. m³ verdünntes Mischwasser in die Gewässer abgeschlagen. Von 6 berichtspflichtigen Mischwasserrückhaltebecken gab es 2024 sechs Entlastungen in ein Gewässer. Im Berichtszeitraum gab es keine Betriebsstörung bei den berichtspflichtigen Pumpwerken.
Die Liegenschaften von HAMBURG WASSER sind im gesamten Hamburger Stadtgebiet sowie in der Metropolregion verteilt. Der Bebauungsgrad reicht von sehr dicht bebauten Grundstücken, wie den Netzbetriebsstandorten und dem Klärwerk im Hamburger Hafen, bis hin zu naturnahen Flächen (Brunnenstandorte und einige Wasserwerksgelände). Die Versiegelungsgrade der verschiedenen Standortkategorien können der Umwelterklärung 202119 entnommen werden. Eine Neubewertung der Versiegelungsgrade der Standorte soll im Vierjahresrhythmus erfolgen.
Insgesamt nehmen die EMAS-Standorte eine Fläche von 2,19 Mio. m² ein, das entspricht einer Fläche von rund 300 Fußballfeldern. Eine Übersicht über alle Standorte mit ihrer jeweiligen Gesamtfläche und der davon anteilig versiegelten Fläche ist Anhang II zu entnehmen.
HAMBURG WASSER hat den „Vertrag für Hamburgs Stadtgrün” im Juni 2021 mit dem Hamburger Senat unterzeichnet. Der „Vertrag für Hamburgs Stadtgrün” basiert auf dem Bürgerschaftlichen Ersuchen (Drucksache 21/16980) zur Umsetzung der Initiative „Hamburgs Grün erhalten”. HAMBURG WASSER hat sich dabei verpflichtet die Naturqualität bei der Bewirtschaftung der eigenen Flächen zu erhöhen. Zusätzlich soll damit das „Grüne Netz” in Hamburg geschützt und weiterentwickelt werden. Konkret hat sich HAMBURG WASSER bereit erklärt, die folgenden Aufgaben umzusetzen:
Einigung auf einen Standard als Grundlage für die Abstimmung der Pachtverträge, die Naturschutzgebiete, geschützte Biotope oder Ausgleichsflächen betreffen.
Gebietseigenes Saat- und Pflanzengut nach Möglichkeit bei Begrünungsmaßnahmen zu verwenden.
Gemeinsam mit der BUKEA20 zu prüfen, ob für Flächen von HAMBURG WASSER Pflege- und Entwicklungspläne erstellt werden können.
Neue Betriebsgebäude mit einem vereinbarten Flächenanteil auf dem Dach und an der Fassade zu begrünen.
Als Dienstleister für wasserwirtschaftliche Fragen im Grünen Netz für alle Vertragspartner von Hamburgs Stadtgrün zur Verfügung zu stehen.
2024 fanden diverse Aktivitäten statt, welche auf die Umsetzung dieser Ziele einzahlen. So wurde beispielsweise eine Wildblumenwiese an einem Pumpwerk umgesetzt. Zusätzlich bereitet HAMBURG WASSER die nachhaltige Entwicklung einzelner Betriebsstandorte vor. Die bisherigen Aktivitäten zur Erhöhung der Naturqualität auf den Flächen von HAMBURG WASSER können Tabelle 3‑4 entnommen werden.
Tabelle 3‑4: Zusammenfassung der bisherigen Aktivitäten HAMBURG WASSERs zur Erhöhung der Naturqualität auf den Standortflächen des Unternehmens
| Kategorie | Maßnahmenbeispiele | Standorte |
|---|---|---|
| Veränderte Bewirtschaftung, | Mähfreier Mai (zweimal im Jahr, nicht im Mai) | WW Großhansdorf, WW Curslack; WW Neugraben |
| Hochgrasmäher | WW Neugraben, WW Bostelbek | |
| Blühwiesen | Blühwiese- und Schmetterlingsfreundliche Wiese | Rothenburgsort, Kaltehofe, WW Süderelbmarsch |
| Aufforstung und ökologischer Waldumbau | Ökologischer Waldumbau | Umland; WW Lohbrügge |
| Aufforstungsprojekt | WW Glinde | |
| „Fame Forest”21 | WW Schnelsen | |
| Naturnahe Bewirtschaftung | Anpflanzung und Bewirtschaftung von Streuobstwiesen durch Projekt "Das Geld hängt an den Bäumen gGmbH"22 | WW Curslack, WW Schnelsen, |
| Totholzhecken | Köhlbrandhöft, Netzbetrieb Nord | |
| Schafbeweidung | Netzbetrieb Nord | |
Insekten Imkerei |
Insektenhotels | Kaltehofe, WW Süderelbmarsch, Rothenburgsort, |
| Verträge mit Imkern | WW Curslack, WW Nordheide, WW Schnelsen, WW Glinde, WW Langenhorn | |
| Nistkästen | Nistkästen, Fledermauskästen | WW Neugraben, WW Bostelbek |
| Biotopentwicklung Digitalisierung Kartierung | Interne Nutzung des Biotopkatasters der FHH | Alle EMAS-Standorte |
| Unterstützung der Entwicklung von Gewässerrandstreifen in Naturschutzgebieten | WW Süderelbmarsch |
Die Pflege, Instandhaltung und Installation von eigenen Gründächern erfolgt durch HAMBURG WASSER. Bei den derzeit und zukünftig in Planung befindlichen Neu- und Umbauten ist die Installation von Gründächern und Fassadenbegrünung vorgesehen. 2024 wurden folgende Gründächer gebaut:
Gründach auf dem Fahrradschuppen auf dem Werksgelände in Rothenburgsort
Dachbegrünung auf einem Nebengebäude auf dem Wasserwerk Billbrook (77 m²)
Schutzdächer gegen Eisabwurf auf dem Klärwerk Dradenau (745 m²)
2025 soll der Reinwasserbehälter auf dem Wasserwerk Curslack mit einem Gründach fertig gestellt werden. Zusätzlich sind Solargründächer und begrünte Fassaden für folgende Projekte vorgesehen:
am Pumpwerk Neugraben,
auf dem Wasserwerk Langenhorn
auf dem Klärwerk Köhlbranddeich: Containerhalle
auf dem Klärwerk Köhlbranddeich: Fahrzeug- und Logistikhalle.
Ausnahmen entstehen nur, sofern eine Begrünung aus technischen und betrieblichen Gründen nicht möglich ist, beziehungsweise der Denkmalschutz eine Dachbegrünung nicht zulässt. Begrünte Dachflächen tragen zur Verbesserung der Umweltleistung bei, indem sie die Biodiversität fördern und den Wasserhaushalt positiv beeinflussen.
HAMBURG WASSER steht u.a. in Kontakt mit dem Schulbau Hamburg (SBH) und unterstützt das Unternehmen bei einem bestmöglichen Regenwasserrückhalt auf ihren Liegenschaften. Dabei wurden 2024 mehrere Schulhofumgestaltungen unterstützt. Hierzu gehört u.a. das folgende Projekt:
Durch das Projekt wurde gezeigt, wie durch gezielte Maßnahmen klimafreundliche Schulhöfe geschaffen werden können. Zusätzlich arbeitet HAMBURG WASSER mit dem bezirklichen Sportstättenbau und dem Gebäudemanagement Hamburg (GMH) zusammen. Dabei werden sanierungsbedürftige Anlagen zur Entlastung möglicher Überflutungsschwerpunkte überprüft.
Bereits seit 2011 deckt HAMBURG WASSER seinen Strombedarf zu 100 % aus erneuerbaren23 Energien. Dabei wird ein Großteil der benötigten Energie (Strom und Wärme) in eigenen Anlagen erzeugt. Energieüberschüsse werden in Form von Strom, Fernwärme und Biomethan24 in externe Netze eingespeist. Darüber hinaus steigen die Anforderungen an eine resiliente Energieversorgung für die kritische Infrastruktur, denen HAMBURG WASSER mit dem weiteren Ausbau der eigenen und möglichst autarken Energieerzeugung begegnen will. Auf Unternehmensebene wird eine Steigerung der Eigenversorgung mit regenerativem Strom auf 85 % bis 2025 angestrebt und bis 2030 hat sich HAMBURG WASSER vorgenommen, die Eigenversorgungsquote mit regenerativem Strom auf 100% zu erhöhen.
Elektrische Energie wird z. B. als Antriebsenergie für Motoren und Pumpen zur Förderung, Aufbereitung und zum Transport von Wasser und Abwasser sowie zur Behandlung von Abwasser und Verwertung (Verbrennung) von Klärschlamm benötigt. Der gesamte Stromverbrauch von HAMBURG WASSER betrug 2024 rd. 168,3 GWh und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (2023: 164,5 GWh). Der Energieeinsatz von Strom bei HAMBURG WASSER 2024 im Vergleich zu den Vorjahren ist in Abbildung 3‑6 dargestellt und wurde zur besseren Vergleichbarkeit mit der diesjährigen Umwelterklärung an die Darstellungsform der Emissionsberichtserstattung im Kapitel Emissionen angepasst.
Dem Energieeinsatz von Strom steht eine Stromeigenerzeugung aus erneuerbaren Energien in Höhe von ca. 123,90 GWh gegenüber. HAMBURG WASSER betreibt mit Faulgas eine Gasturbine und zwei Gasmotoren sowie mit Dampf aus der Klärschlammverbrennung eine Dampfturbine. Der Strom aus vier eigenen Windenergieanlagen wird zum großen Teil selbst genutzt, überschüssiger Strom wird ins Stromnetz eingespeist. In geringem Maße tragen auch Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern zur Erzeugung von elektrischer Energie bei. Weiterhin wird im Trinkwassernetz Energie zurückgewonnen. Damit konnte sich HAMBURG WASSER 2024 zu ca. 74% mit regenerativem Strom selbst versorgen. In den nächsten Jahren werden weitere Projekte umgesetzt, um das Ziel der Eigenstromversorgung von 100% aus regenerativen Quellen zu erreichen. Außerdem werden an mehreren Standorten Blockheizkraftwerke betrieben. Die Stromeigenerzeugung ist in Abbildung 3‑7 dargestellt. Diese ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies ist unter anderem auf die Inbetriebnahme der vierten Windenergieanlage, welche 2024 im ersten vollen Betriebsjahr war, zurückzuführen.
Tabelle 3‑5 zeigt den spezifischen Stromverbrauch der Wasserwerke und des Klärwerks. 2024 ist der spezifische Stromverbrauch der Trinkwasserproduktion auf 0,438 kWh/m³ gesunken (2023: 0,446 kWh/m³). Die Abnahme des spezifischen Energieverbrauchs ist auf Erneuerungen von Brunnen- und Reinwasserpumpen sowie weitere Energiesparmaßnahmen zurückzuführen. Der spezifische Stromverbrauch des Klärwerks lag 2024 bei 0,556 kWh/m³. Dieser ist neben der Energieeffizienz einzelner Prozesse auch stark von der behandelten Abwassermenge abhängig, die 2024 um ca. 14,5 Mio. m³ Abwasser höher war als 2023.
Tabelle 3‑5: Spezifischer Stromverbrauch25 ausgewählter Unternehmensbereiche
| Spezifischer Stromverbrauch | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Wasserwerke | kWh/m³ | 0,457 | 0,446 | 0,438 |
| Klärwerke | kWh/m³ | 0,649 | 0,581 | 0,556 |
Wärmeenergie wird vor allem im Klärwerk bei der Schlammbehandlung und zur Gebäudebeheizung benötigt. Der gesamte direkte Wärmeenergieverbrauch von HAMBURG WASSER betrug 2024 rd. 104,9 GWh. Das ist etwas niedriger als der Verbrauch des Vorjahres (2023: 107,4 GWh). In Abbildung 3‑8 wird eine Übersicht über den Energieeinsatz für die Wärmeversorgung in den letzten drei Jahre gegeben. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde mit dieser Umwelterklärung die Darstellung an die Darstellungsform der Emissionsberichtserstattung im Kapitel Emissionen angepasst.
Dem Verbrauch gegenüber steht eine Wärmeerzeugung aus regenerativen Energien auf dem Klärwerk in Höhe von 127,7 GWh (vgl. Tabelle 3‑6). Die Wärmeerzeugung aus regenerativen Energien ist für die letzten drei Jahre in Abbildung 3‑9 dargestellt.
Der gesamte direkte Kraftstoffverbrauch von HAMBURG WASSER betrug 2024 8,96 GWh26 und ist damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2023: 6,36 GWh). Auf insgesamt 4,59 Mio. gefahrene Kilometer wurden dabei durch den Fuhrpark 675.243 Liter Kraftstoff27 verbraucht, was einer Erhöhung des Literverbrauches gegenüber dem Vorjahr um 3% entspricht. Die Steigerung des Kraftstoffverbrauchs begründet sich unter anderem auf die reduzierte Verfügbarkeit von CNG im Tätigkeitsgebiet von HAMBURG WASSER, sodass bei Fahrzeugbetankungen auf Benzin zurückgegriffen werden musste. Die Entwicklung des Kraftstoffverbrauchs wird im Vergleich zu den Vorjahren in Abbildung 3‑10 dargestellt.
Dem Verbrauch gegenüber steht die Erzeugung von Biomethan aus Faulgas und dessen Einspeisung in das Gasnetz in Höhe von 60 GWh. Die Erzeugung von Biomethan ist für die letzten drei Jahre in Abbildung 3‑11 dargestellt und konnte 2024 aufgrund der steigenden Faulgasmengen wieder erhöht werden.
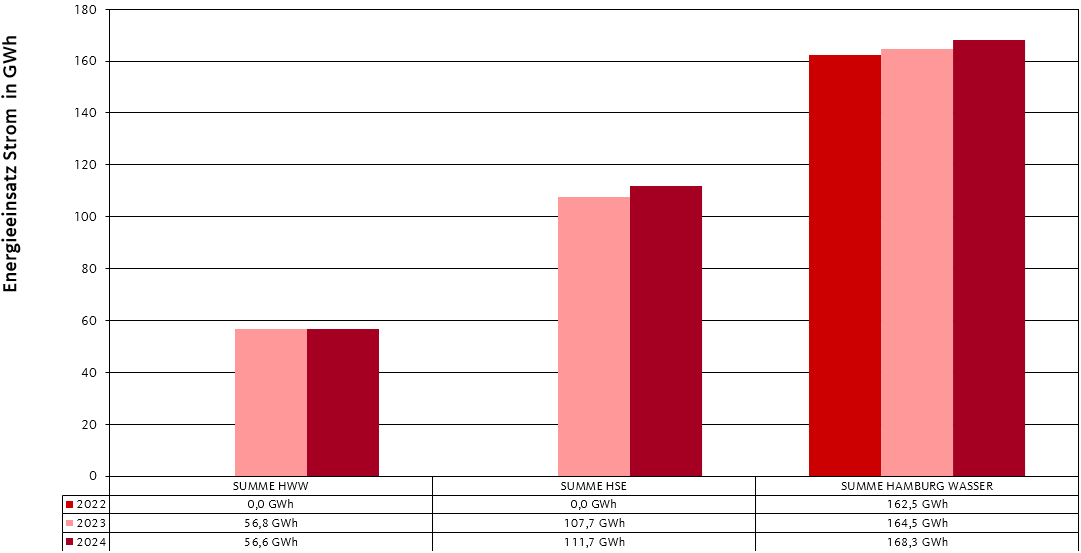
Abbildung 3‑6: Energieeinsatz Strom bei HAMBURG WASSER 202428 und Vorjahre29
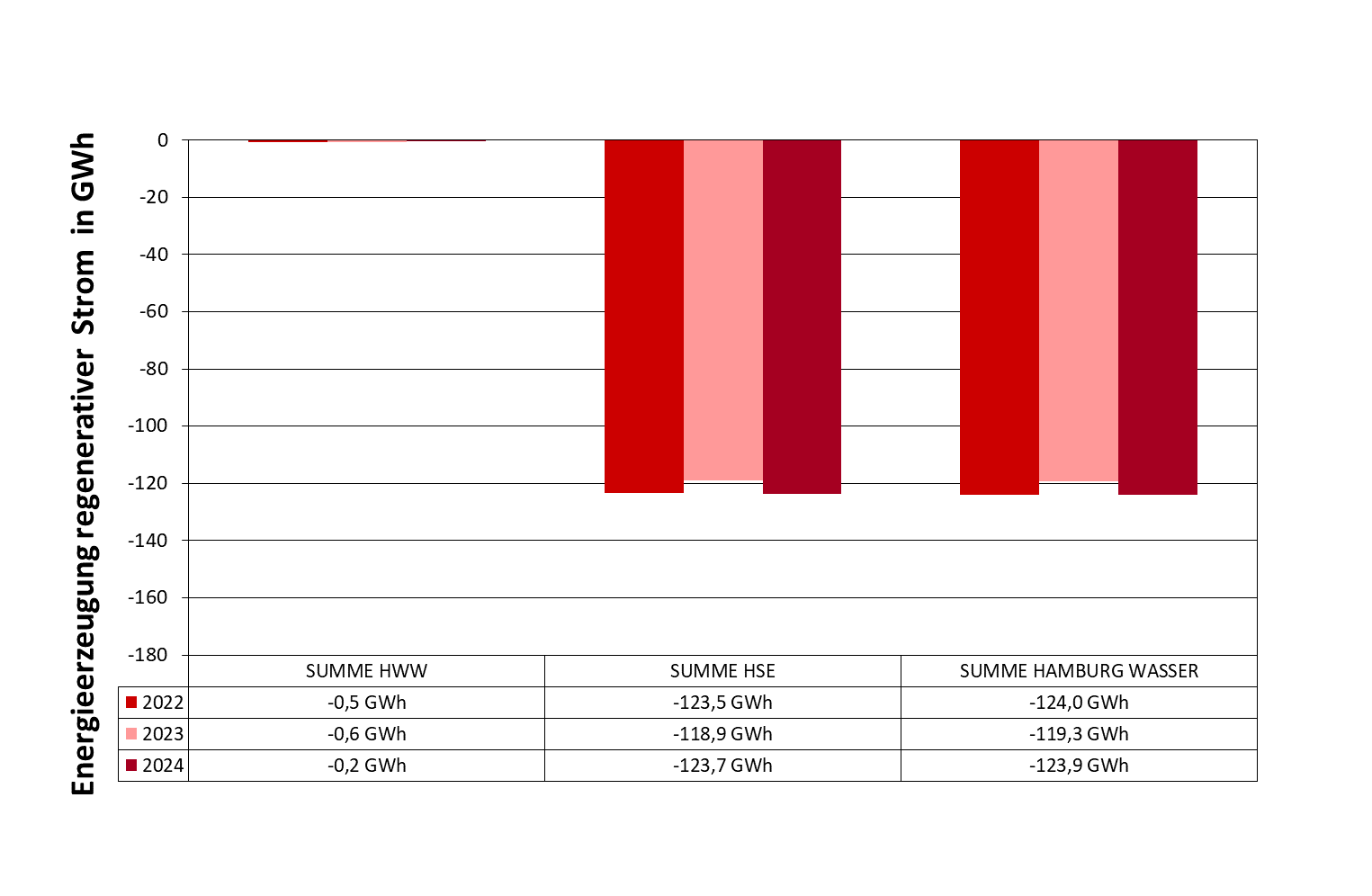
Abbildung 3‑7: Energieerzeugung regenerativer Strom bei HAMBURG WASSER 202422 und Vorjahre
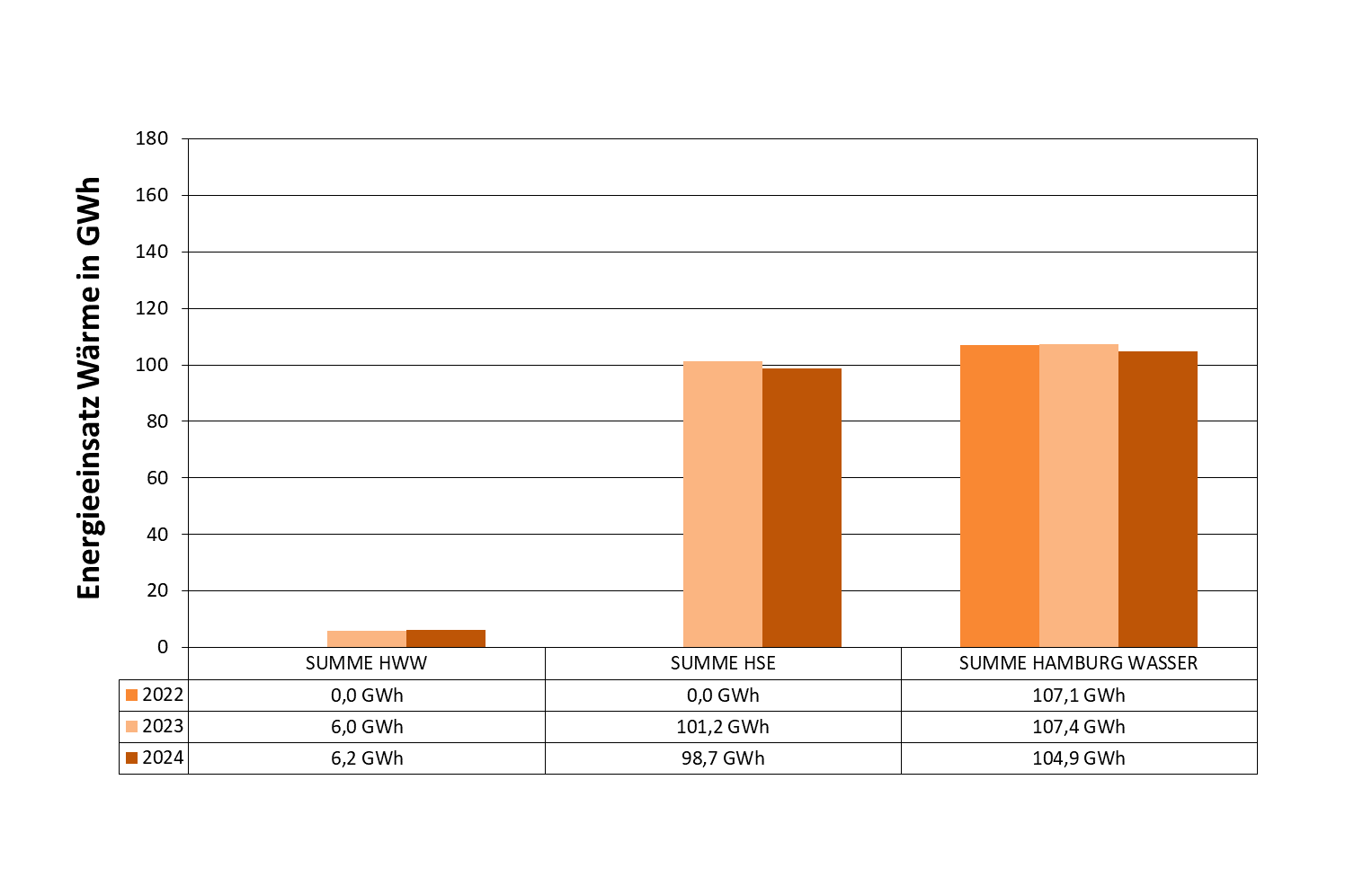
Abbildung 3‑8: Energieeinsatz Wärme bei HAMBURG WASSER 202422 und Vorjahre30
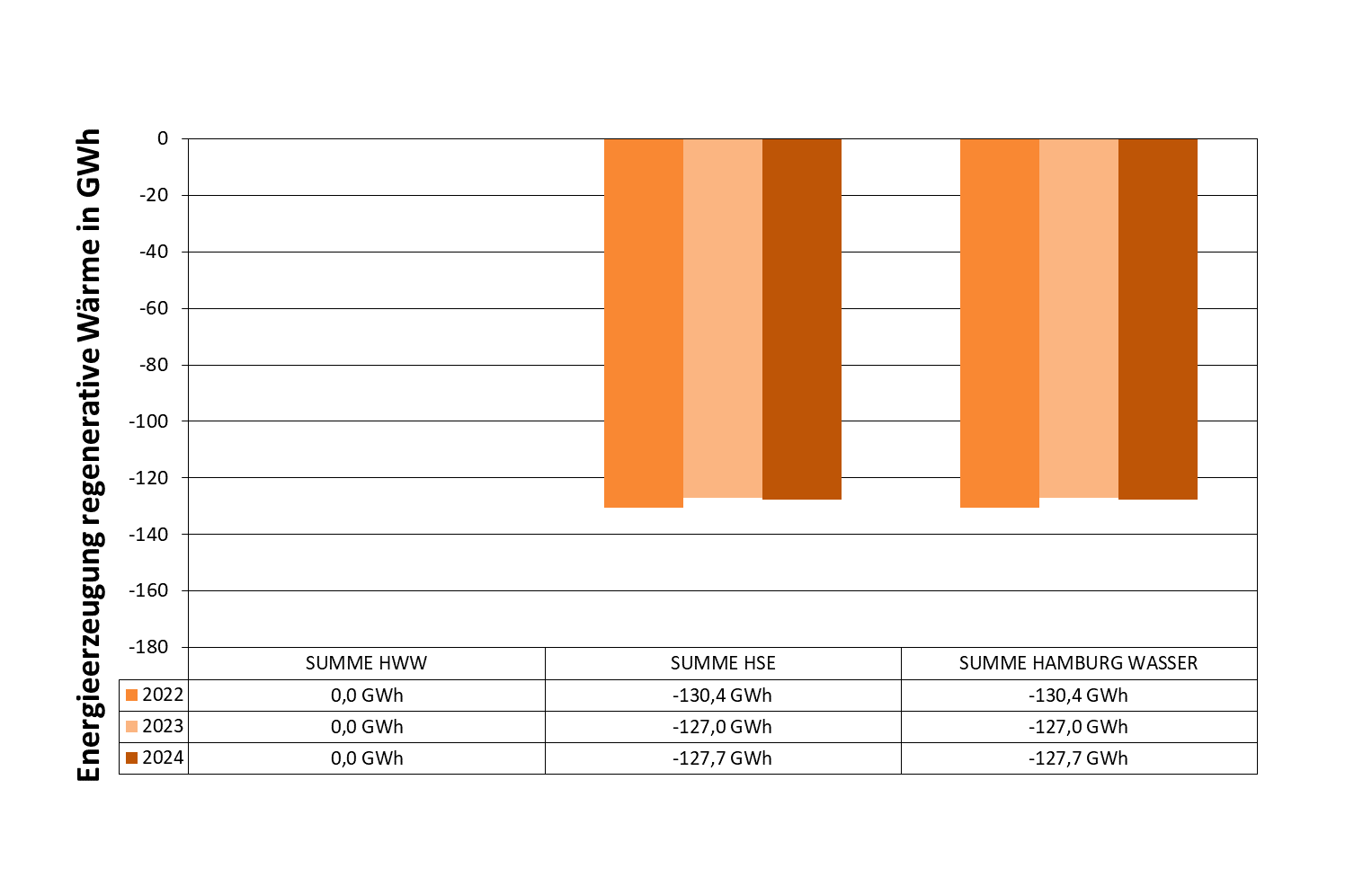
Abbildung 3‑9: Energieerzeugung regenerative Wärme bei HAMBURG WASSER 202422 und Vorjahre
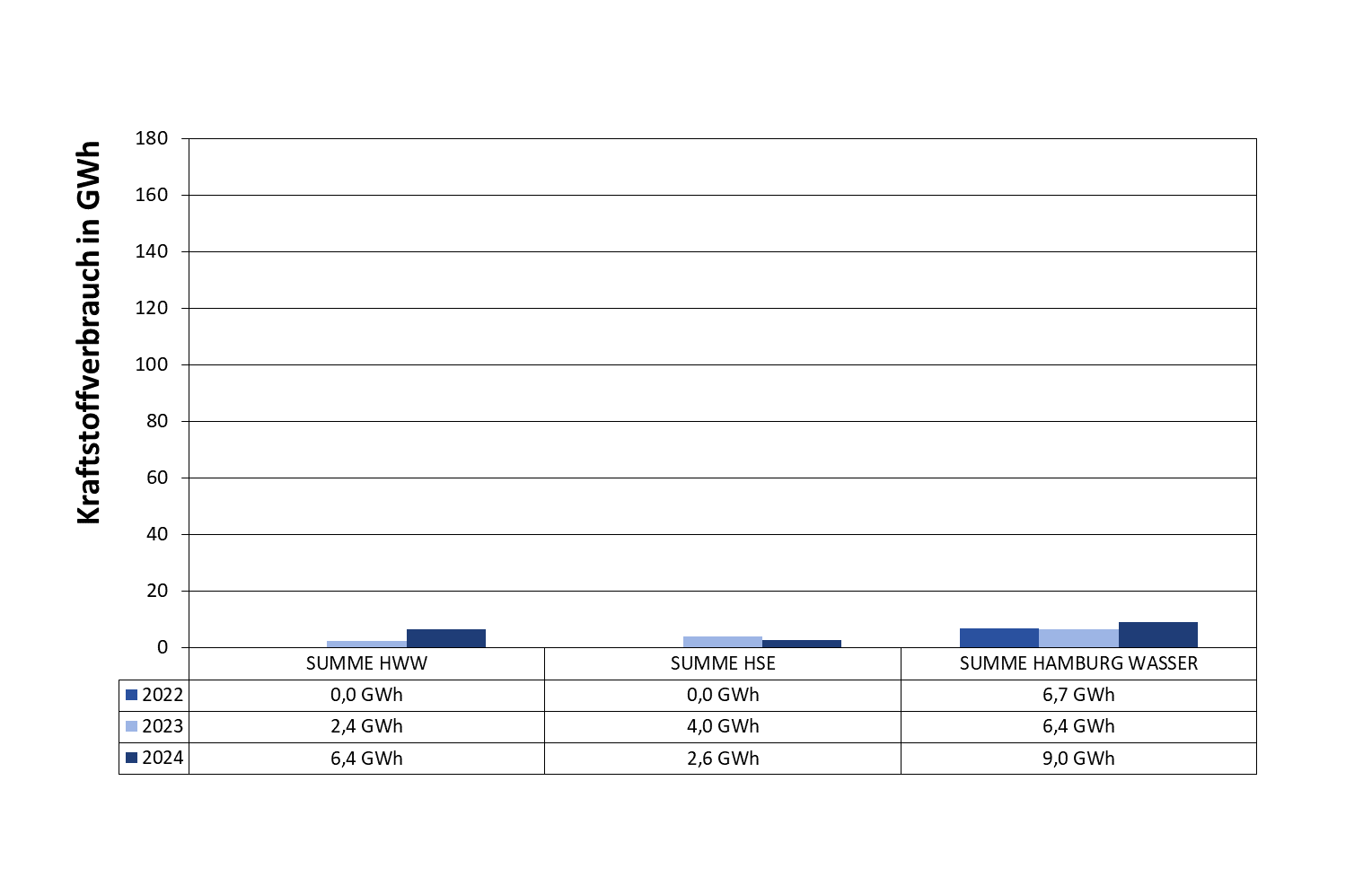
Abbildung 3‑10: Kraftstoffverbrauch bei HAMBURG WASSER 202422 und Vorjahre
Abbildung 3‑11: Erzeugung regenerative Kraftstoffe bei HAMBURG WASSER
202422 und Vorjahre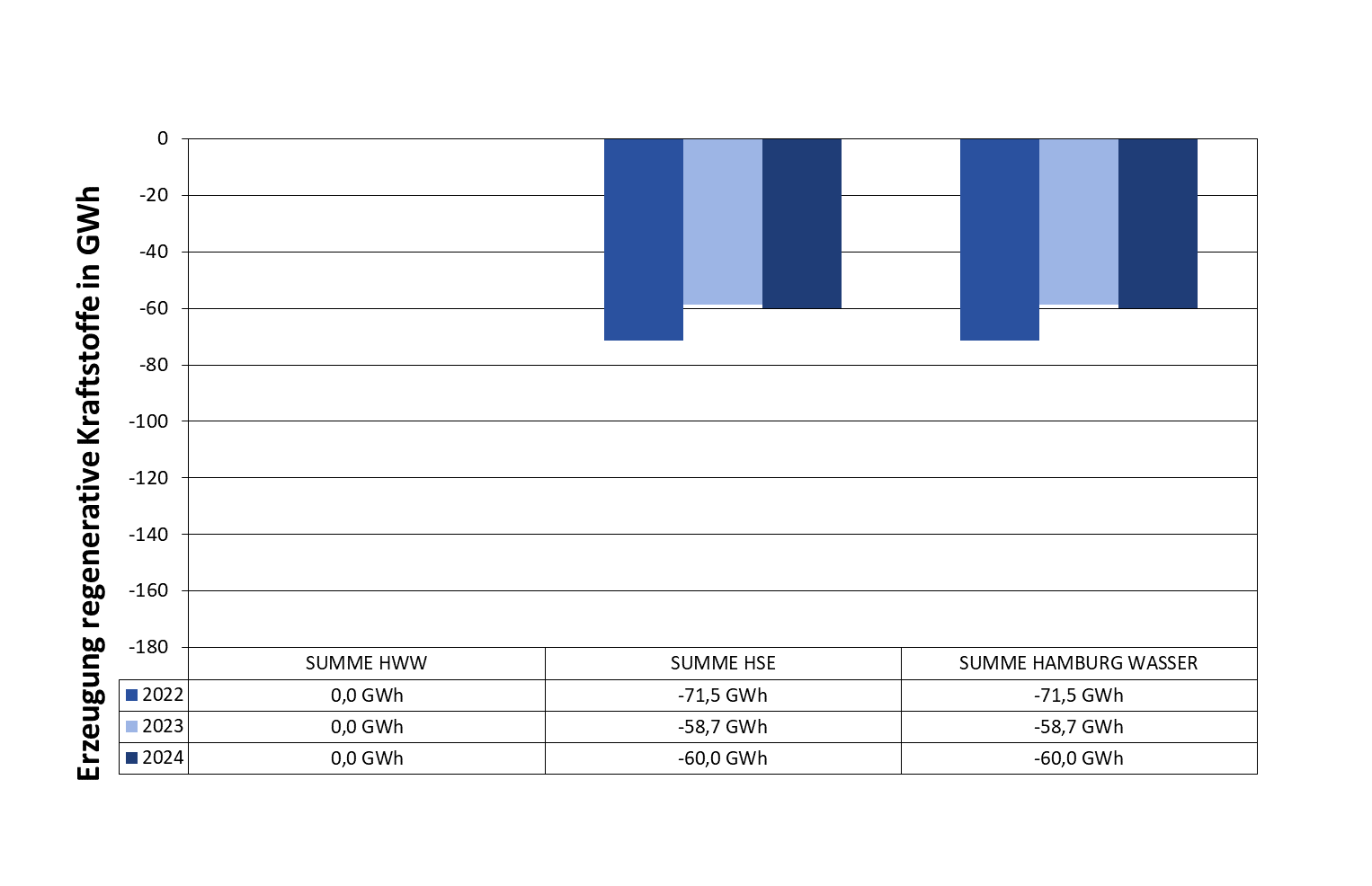
Das Klärwerk Hamburg ist derjenige Standort von HAMBURG WASSER mit sowohl den größten Energieverbräuchen als auch mit der größten Menge an eigenerzeugter Energie. Daher werden die Strom- und Wärmeströme an diesem Standort im Folgenden näher betrachtet.
Es werden folgende Systemgrenzen angewendet: Der Energieverbrauch umfasst die in den klärwerkseigenen Anlagen an den Standorten Köhlbrandhöft, Dradenau und im Pumpwerk Hafenstraße verbrauchte elektrische Energie und Wärmeenergie, ohne die Strom- bzw. Wärmeabgabe an andere (Baustellen, Hamburg Port Authority, Container Terminal Tollerort). Die Energieerzeugung beinhaltet die auf dem Gelände gewonnene Energie aus regenerativen Quellen.
Die Energieströme inklusive der Mengenbilanzen differenziert nach Strom und Wärme sind für 2024 in Abbildung 3‑12 und Abbildung 3‑13 dargestellt. Abbildung 3‑15 zeigt die Faulgasverwertung. Der Stromverbrauch des Klärwerks Hamburg umfasst die Abwasserreinigung, Schlammbehandlung und Klärschlammverbrennung. Dieser ist 2024 mit 101,9 GWh im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (2023: 98,0 GWh). Eine Ursache ist die höhere gereinigte Abwassermenge im Bezugsjahr. Demgegenüber steht eine Stromproduktion von 123,1 GWh. Diese konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden (2023: 118,4 GWh). Diese Steigerung ist auf den Zubau der vierten Windenergieanlage auf dem Klärwerksstandort zurückzuführen, die 2024 erstmals ganzjährig in Betrieb war. Eine Übersicht über den Eigenverbrauch, die Energieeigenerzeugung und die Eigenerzeugungsquote des Klärwerks wird in Tabelle 3‑6 gegeben. In 2024 lag die Eigenerzeugungsquote des Klärwerks für Strom bei ca. 121% und damit auf ähnlichem Niveau des Vorjahreswertes (2023: 120%).
Das Gesamtziel, den Energiebedarf (Strom und Wärme) des Klärwerkes bilanziell zu 100 % durch an den Klärwerksstandorten eigenerzeugte, regenerative Energien zu decken, wurde auch 2024 erreicht (vgl. Tabelle 3‑6). Ausschließlich die Gebäude außerhalb des Wärmenetzes werden mit Erdgas bzw. mit Öl beheizt. 2024 betrug der Wärmeverbrauch des Klärwerks 98 GWh. Demgegenüber steht die Wärmeerzeugung aus regenerativen Quellen, die mit 128,60 GWh den Wärmebedarf auch in 2024 übertraf. Die Eigenerzeugungsquote für Wärmeenergie des Klärwerks lag bei rd. 130% und ist damit ähnlich gegenüber der Quote des Vorjahrs (2023: 130%). Seit 2009 wird der benachbarte Container Terminal Tollerort über eine Fernwärmeleitung mit Wärmeenergie aus dem Klärwerk Hamburg versorgt. Die Phosphorrecycling-Anlage (HPHOR) der 2018 gegründeten Tochter Hamburger Phosphorrecycling GmbH31, die auf dem Gelände des Klärwerks liegt, wird mit Dampf aus der VERA und Strom aus dem Klärwerk versorgt.
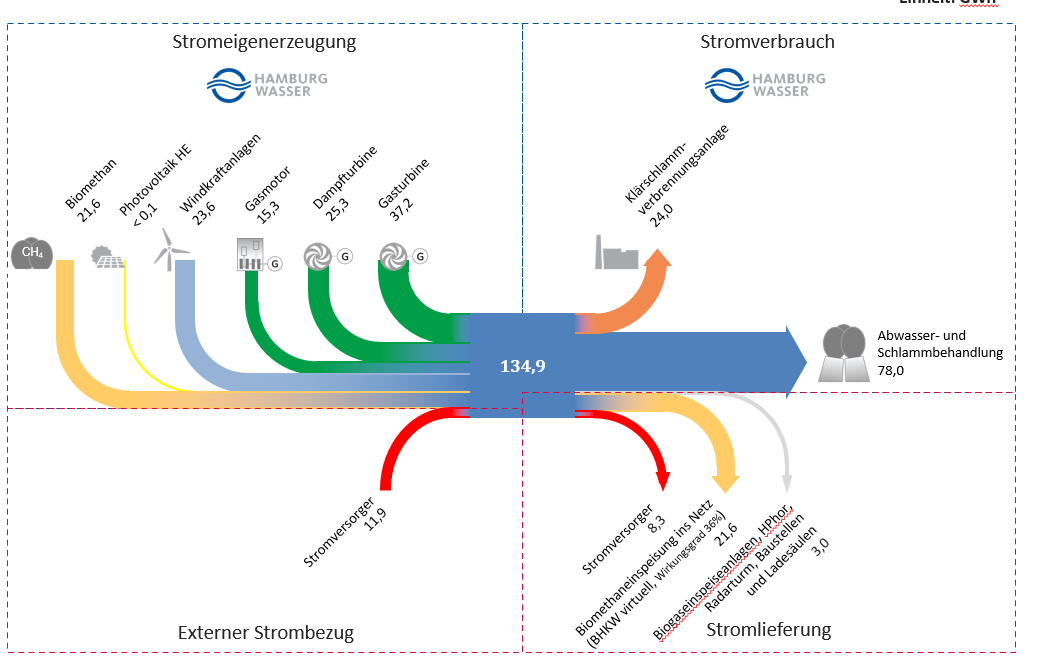
Abbildung 3‑12: Schematische Darstellung der Energieströme für elektrische Energie des Klärwerks Hamburg 2024, Angaben in GWh
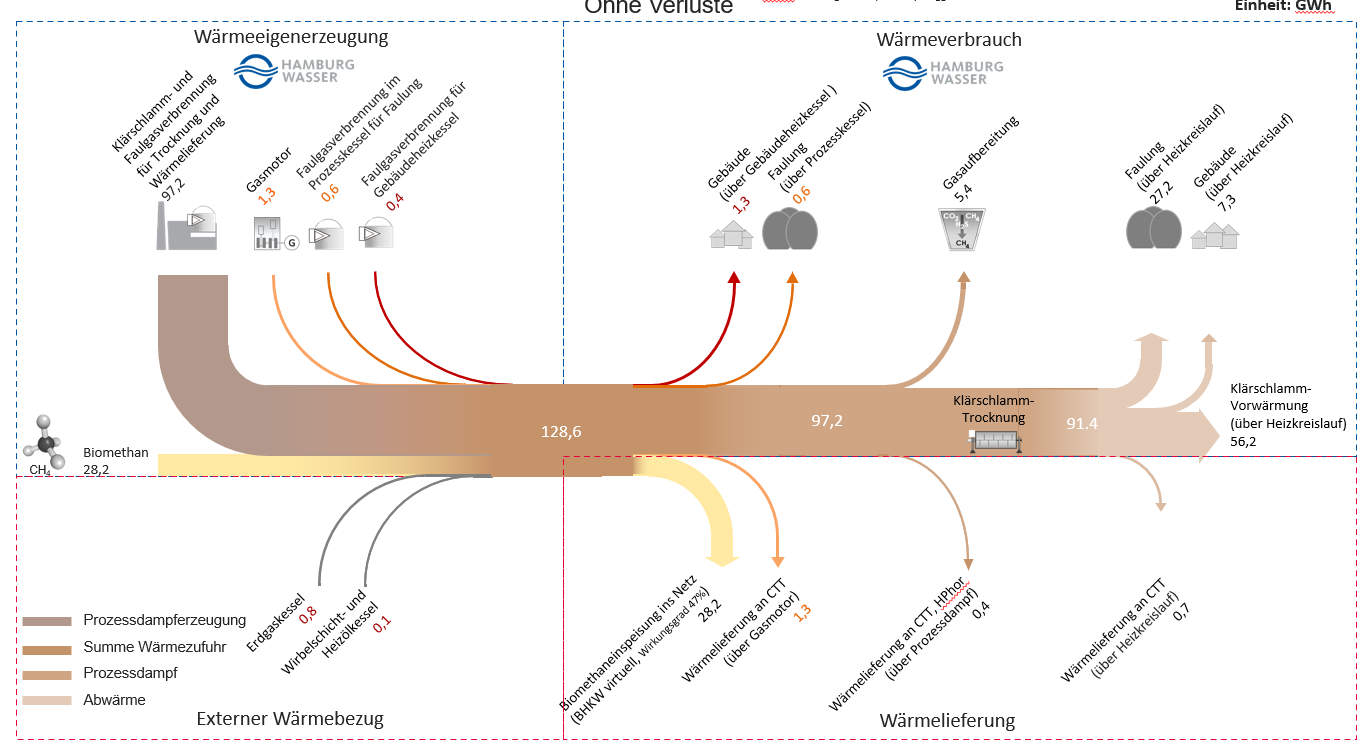
Abbildung 3‑13: Darstellung Wärmeenergieflussschema des Klärwerks Hamburg 2024, Angaben in GWh
Die Faulgasproduktion des Klärwerks Hamburg lag 2024 bei 37,10 Mio. Nm³ und ist somit im Vergleich zum Vorjahr (2023: 36,8 Mio. Nm³) wieder leicht gesteigert worden (siehe Abbildung 3‑14).
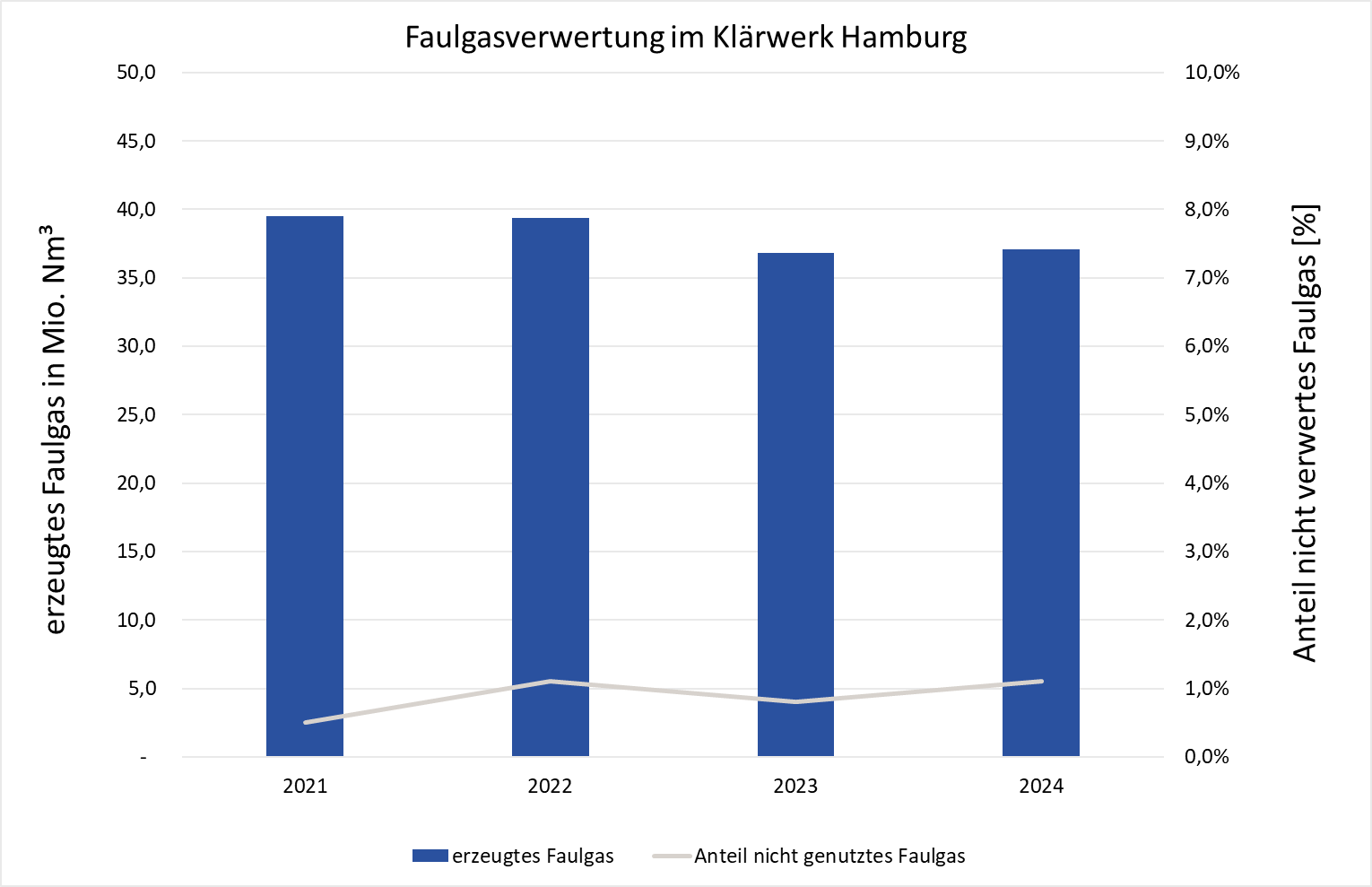
Abbildung 3‑14: Faulgaserzeugung und -verwertung im Klärwerk Hamburg
Seit 2019 hat sich der prozentuale Anteil des nicht verwendeten Faulgases deutlich reduziert. Der Grund für die signifikante Reduktion ist die Inbetriebnahme der GALA 2, welche 2020 erfolgte. Wie erwartet, lag die Fackelverlustrate 2024 mit 1,1% deutlich unter der angestrebten Verlustrate von 1,5 %.
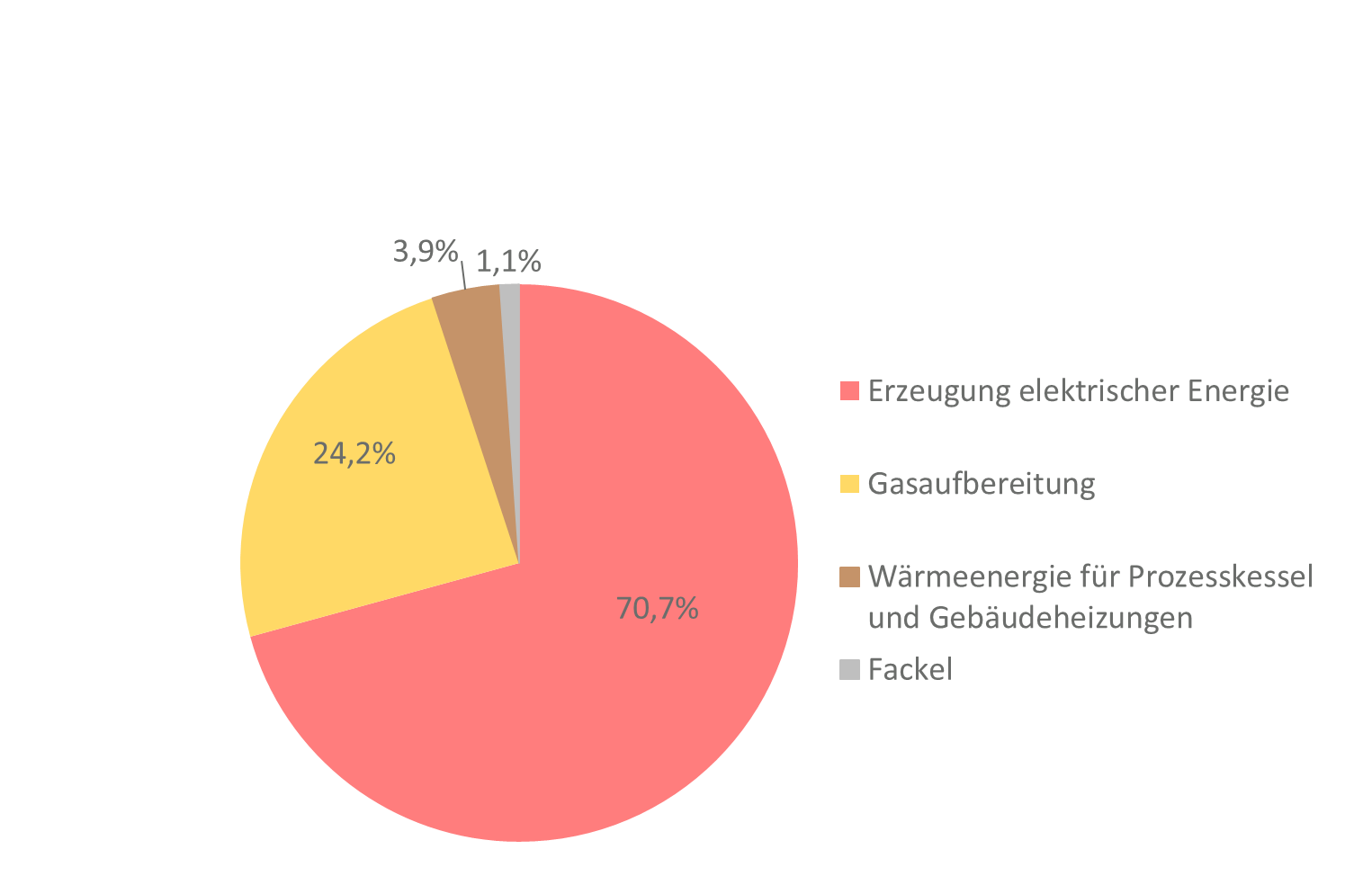
Abbildung 3‑15: Faulgasverwertung 2024
Die Gasaufbereitungs- und Einspeisungsstationen (GALA 1 und 2) bereiten insbesondere in Spitzenzeiten der Windstromproduktion Teile des im Klärwerkprozesses erzeugten Faulgases auf und speisen es als Biomethan in das Gasnetz ein. Die GALAs realisieren somit einen alternativen Weg der Faulgasnutzung und reduzieren die Fackelverlustrate. Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, die Faulgasverstromung flexibel an den Strombedarf und die fluktuierende Windstromproduktion anzupassen. 2024 wurde Biomethan mit einem Energieäquivalent von insgesamt 60 GWh aufbereitet. Dies ist etwas höher als im Vorjahr (2023: 58,70 GWh) und auch auf die insgesamt etwas höhere Faulgaserzeugung zurückzuführen. Zukünftig soll ein noch größerer Teil des Faulgases als Biomethan aufbereitet und in das Gasnetz eingespeist werden.
Über die Biomethaneinspeisung könnte virtuell ein Blockheizkraftwerk Strom und Wärme erzeugen. Um die Energieerzeugung aus Biomethan angeben zu können, wird daher davon ausgegangen, dass ein typisches Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 36 % und einem thermischen Wirkungsgrad von 47 % betrieben wird. Daraus folgt eine virtuelle Stromerzeugung von 21,60 GWh und eine virtuelle Wärmeerzeugung von 28,20 GWh aus dem Verkauf des Biomethans.32 Die noch fehlende Differenz von 10,20 GWh sind als Verluste anzusehen.
Abbildung 3‑13 zeigt die Wärmeströme des Klärwerks Hamburg 2024. Wärmeerzeuger im Klärwerk waren aus der Klärschlammverbrennung ausgekoppelte Prozesswärme, die Biomethaneinspeisung („virtuelle Wärmeerzeugung”) und mehrere mit Faul- oder Erdgas betriebene Heizkesselanlagen. Für den Havariefall, in dem kein Faulgas vorhanden wäre, werden zudem einzelne Heizölanlagen vorgehalten.
Zukünftig wird HAMBURG WASSER aus dem Ablauf der Kläranlage auf der Dradenau bis zu 60 MW (thermisch) an Abwasserwärme mittels elektrischer Großwärmepumpen erzeugen und in das erweiterte öffentliche Fernwärmenetz einspeisen. Damit leistet HAMBURG WASSER einen nennenswerten Beitrag für die Wärmewende in Hamburg. Die Anlage befindet sich derzeit im Bau.
Tabelle 3‑6: Energiebilanz des Klärwerks Hamburg 2024, Verbrauch und Eigenerzeugung differenziert nach Strom und Wärme
| Energiebilanz Klärwerk Hamburg | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Stromverbrauch | GWh | 99,5 | 98,6 | 101,9 |
| Stromeigenerzeugung | GWh | 123,1 | 118,4 | 123,1 |
| Eigenerzeugungsquote Strom | % | 124% | 120% | 121% |
| Wärmeverbrauch | GWh | 95,1 | 97,4 | 98,0 |
| Wärmeeigenerzeugung | GWh | 130,4 | 127,0 | 127,7 |
| Eigenerzeugungsquote Wärme | % | 137% | 130% | 130% |
Insgesamt betreibt HAMBURG WASSER seit Mitte 2023 vier Windenergieanlagen auf dem Gelände des Klärwerks Hamburg. Außerdem ist die Planung um mehrere weitere große Windenergie- und PV-Anlagen v.a. auf dem Klärwerk und den Wasserwerksstandorten erweitert worden. Da hier erst die Planungs- und Genehmigungsphasen laufen, ist mit größeren Einflüssen ab 2027 zu rechnen.
HAMBURG WASSER verfolgt ambitionierte Ziele beim Klimaschutz. Aktuell entsteht ein Klimaschutzplan, der aufzeigen soll, wie die direkten und indirekten Emissionen auf ein klimaverträgliches Maß gesenkt werden können. Neben den durch das Unternehmen ausgestoßenen Emissionen (Fußabdruck) werden im Klimaschutzplan auch die positiven Beiträge von HAMBURG WASSER als Lösungspartner für die Energiewende (Handabdruck) dargestellt. Dabei wird aufgezeigt, in welcher Höhe fossile Emissionen bei Dritten durch die Einspeisungen regenerativer Energie (Strom, Wärme, Biomethan) vermieden werden können.
Der derzeitige Bilanzierungsrahmen erfasst die Emissionen nach Scope 1 und Scope 2 für die EMAS-Standorte in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)33. Für indirekte Emissionen aus vor- und nachgelagerten Prozessketten (Scope 3) ist im Abschnitt „Scope 3 – indirekte Emissionen aus vor- und nachgelagerten Aktivitäten” eine Wesentlichkeitsanalyse dargestellt. Die für die Berichterstattung erforderlichen Daten werden derzeit erhoben.
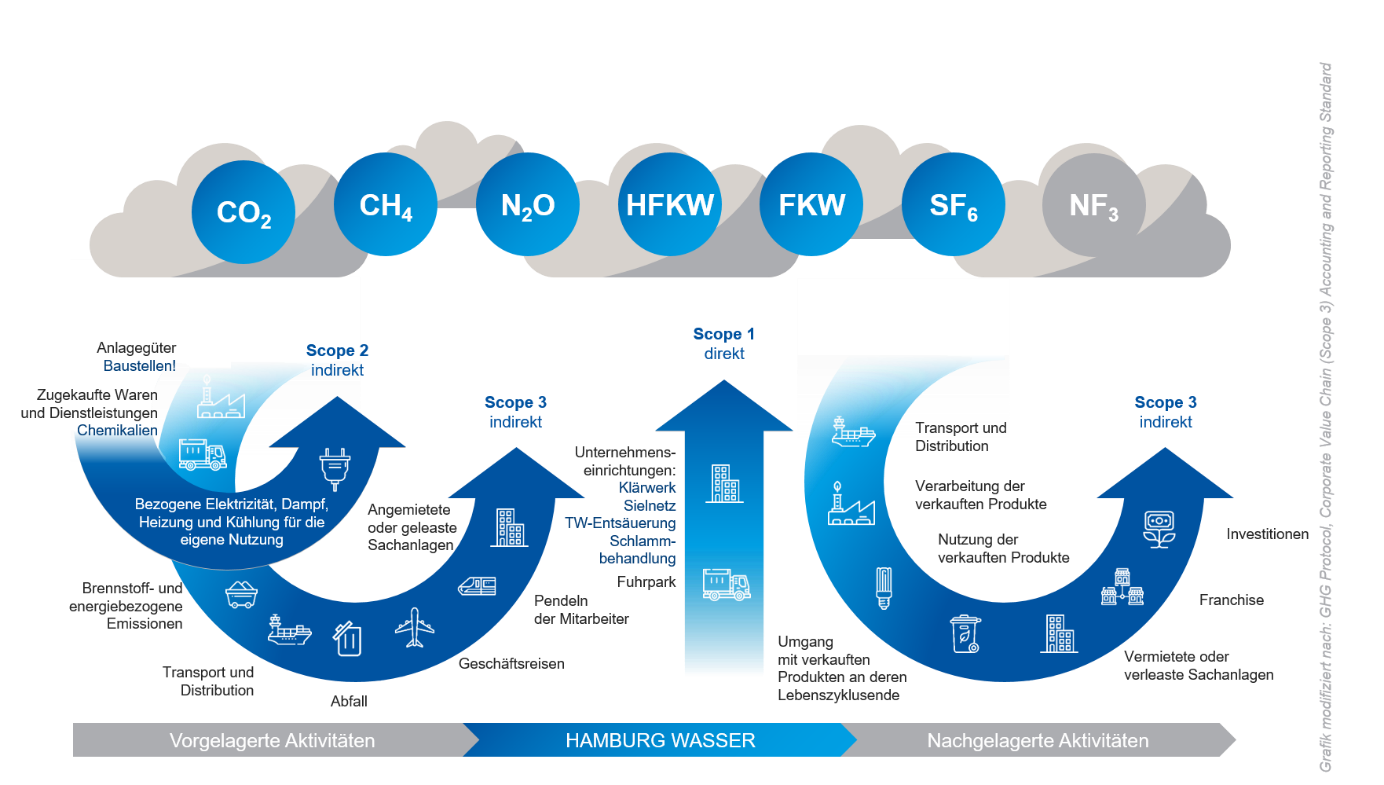
Abbildung 3‑16: Übersicht zu Treibhausgasen und Scopes gemäß GHG Protocol
Grundsätze, Bilanzierungsrahmen und Methodik können im Detail der Umwelterklärung 2022 entnommen werden. Genauso finden sich an dieser Stelle weitergehende Informationen zu den einzelnen Emissionen.
Im Folgenden sind die Treibhausgasemissionsquelle von HAMBURG WASSER dargestellt. Dabei erfolgt eine Gliederung entsprechend des GHG Protocols in Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen. Biogene Emissionen werden separat von diesen drei Scopes berichtet.
Die direkten Emissionen des Scope 1 werden dabei zusätzlich unterteilt in:
Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch,diffuse Emissionen, die bei Leckagen im abnormalen Betriebszustand auftreten,Emissionen, die durch die Prozesse der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung bei HAMBURG WASSER emittiert werden.Die Emissionen der Abwasserableitung werden aktuell nicht berechnet, da es hierfür keine Quantifizierungsansätze gibt.
Bei den indirekten CO2-Emissionen aus dem Energiebezug (Scope 2) wird neben dem Bezug von Ökostrom (marktbasiert) vergleichend die Emissionshöhe bei Ansatz des Bundesstrommix (standortbasiert) dargestellt.
Für die indirekten vor- und nachgelagerten Emissionen des Scope 3 werden derzeit Daten erhoben und Berechnungsansätze erstellt. Für diese Emissionen wird zunächst das Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse dargestellt. Mit verbesserter Datenlage ist zukünftig eine Ausweitung der Berichterstattung im Rahmen der Umwelterklärung geplant.
Bei den Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch handelt es sich um fossiles Kohlenstoffdioxid (CO2). Emissionen resultieren aus dem Fuhrparkbetrieb, dem Betrieb kleiner Feuerungsanlagen und von Blockheizkraftwerken.
Ein wichtiges Potential zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen des Fuhrparks von HAMBURG WASSER liegt in der Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in Verbindung mit der Nutzung von emissionsärmeren Energieträgern. Somit werden insgesamt geringere CO2–Emissionen im Vergleich zu konventionellen Benzin- und Dieselfahrzeugen verursacht. Derzeit liegt der Anteil der Erdgasfahrzeuge bei ca. 28%, der Elektrofahrzeuge bei ca. 9% und der Wasserstoffahrzeuge bei 0,4%.
Im Jahr 2024 ist der Wärmeverbrauch beider Unternehmen im Vergleich zu 2023 etwas zurückgegangen. Dies ist neben dem eher milden Winter auf Energiesparmaßnahmen zurückzuführen sowie auf die Verbesserung der Energieeffizienz einzelner Gebäude und auf den Austausch alter Heizungsanlagen gegen solche, die regenerative Energien nutzen, wie Holzpelletheizungen oder Wärmepumpensysteme.
Die spezifischen CO2-Äq-Emissionen34 aus dem Primärenergieverbrauch betragen für die HWW 14,60 kg CO2-Äq bezogen auf 1.000 m³ erzeugtes und ins Rohrnetz eingespeistes Trinkwasser und für die HSE 9,90 kg CO2-Äq bezogen auf 1.000 m³ behandeltes Abwasser.
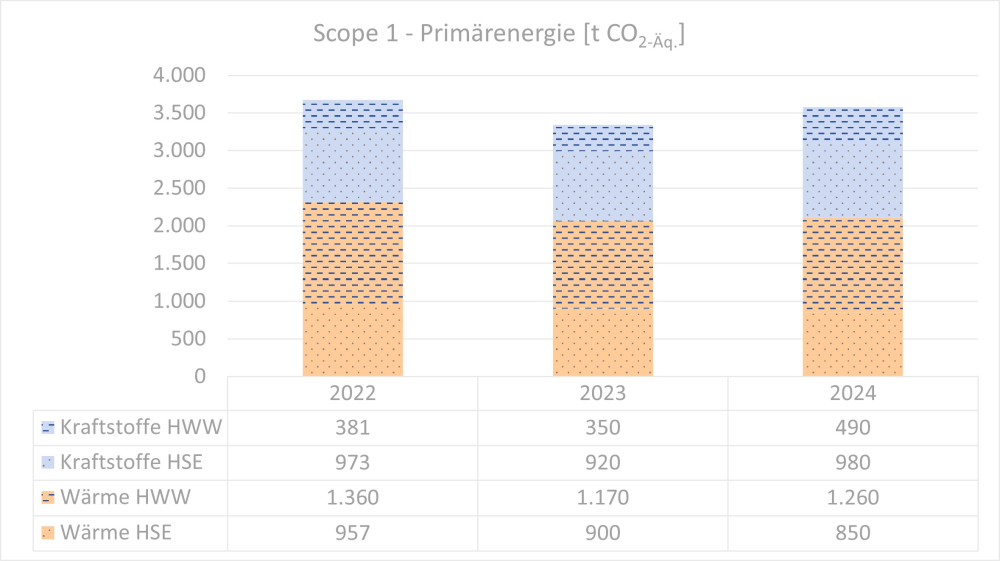
Abbildung 3‑17: Scope 1, Emissionen aus dem Einsatz von Primärenergie
Bei der Nutzung von Klima- und Kälteanlagen sowie bei Mittelspannungsschaltanlagen kann es im abnormalen Betriebszustand zu Leckagen bzw. Betriebsstörungen kommen. Diese diffusen Emissionen von Kältemitteln, d.h. Fluorkohlenwasserstoffen (FKW)35 und teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen (HFKW)36 bzw. Schwefelhexafluorid (SF6) in die Umwelt lassen sich über Nachfüllmengen quantifizieren.
Tabelle 3‑7 gibt einen Überblick über die entsprechenden Emissionen der letzten drei Jahre. Es handelt sich um Emissionen im abnormalen Betriebszustand, die vorfallbezogenen Schwankungen unterliegen.
Tabelle 3‑7: Scope 1, diffuse Emissionen von Kältemitteln (FKW und HFKW) und SF6 im abnormalen Betriebszustand
| Scope 1, diffuse Emissionen | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| SUMME | t CO2-Äq. | 402 | 439 | 400 |
| HWW | t CO2-Äq. | 79 | 0 | 3 |
| HSE | t CO2-Äq. | 323 | 439 | 397 |
| Kältemittelverluste | t CO2-Äq. | 402 | 439 | 400 |
| HWW | t CO2-Äq. | 79 | 0 | 3 |
| HSE | t CO2-Äq. | 323 | 439 | 397 |
| SF6-Verluste bei Mittelspannungsschaltanlagen | t CO2-Äq. | 0 | 0 | 0 |
| HWW | t CO2-Äq. | 0 | 0 | 0 |
| HSE | t CO2-Äq. | 0 | 0 | 0 |
Bei der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung entstehen direkte Treibhausgasemissionen, die dem Scope 1 zuzuordnen sind. Je nach Prozess werden unterschiedliche Mengen der Treibhausgase Lachgas/Distickstoffoxid (N2O), Methan (CH4) und Kohlenstoffdioxid (CO2) freigesetzt. Die Treibhausgas-Äquivalente wurden gemäß dem aktuellen Sachstandsbericht der IPCC (AR6) angepasst und auch rückwirkend für die Vorjahre zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit aktualisiert. Gemäß aktuellem Merkblatt DWA-M 230 handelt es sich bei Kohlenstoffdioxid überwiegend um CO2 biogenen Ursprungs, das nicht als anthropogenes Treibhausgas einzuordnen ist. Laut GHG Protocol ist dieses separat von Scope 1, 2 und 3 zu berichten, da es dem kurzfristigen bzw. kleinen Kohlenstoffkreislauf37 unterliegt. Da die Entstehungsorte jedoch dieselben sind, werden diese Emissionen hier zusammen mit den anderen Emissionen aus Prozessen berichtet. Tabelle 3‑8 gibt einen Überblick über die abgeschätzten Emissionen aus den Prozessen.
Bei der Trinkwasserversorgung handelt es sich um Emissionen von im Grundwasser gelösten Kohlenstoffdioxid und Methan, die bei der Belüftung und Entsäuerung freigesetzt werden. Somit ist das im Grundwasser enthaltene CO2 meist biogener Natur. Es handelt sich bei der Entsäuerung folglich um das Freisetzen von grünem, sich in einem Kreislauf befindlichen CO2, welches früher oder später sowieso in die Atmosphäre entweichen würden. Die Zeitskala dieses Kreislaufes ist allerdings mit Jahren bis Jahrzehnten zu beziffern.
Für die Abschätzung der biogenen CO2-Emissionen aus der Abwasserreinigung, muss auf einen Literaturwert zurückgegriffen werden. Die CO2-Emissionen aus der Schlammbehandlung werden analog zu den Methan-Emissionen bilanziert, da sich Faulgas aus CH4 und CO2 zusammensetzt. Zudem werden die CO2-Emissionen durch die Verbrennung von Klärschlamm und Faulgas berücksichtigt.
Die CH4–Emissionen aus der Abwasserentsorgung inkl. Klärschlammverbrennung beinhalten die Emissionen aus den Faulbehältertaschen, dem Faulschlammstapelbehälter, dem Fremdschlammsilo und 2024 zusätzlich aus den betrachteten Verlusten der Gasaufbereitungsanlagen (GALA).
Die N2O-Emissionen aus der Abwasserentsorgung wurden mit Hilfe des ReLaKo-Ansatzes (DWA-M 230-1) berechnet. Die Jahresfracht der N2O-Emissionen aus der Klärschlammverbrennung wurde aus früheren N2O-Konzentrationsmessungen und den aktuellen Abgasmengen qualifiziert abgeschätzt. Im Jahr 2024 konnten die Messverfahren für die N2O-Konzentrationsmessungen optimiert werden, sodass die Abschätzung der Jahresfrachten der N2O-Emissionen verbessert werden konnte und die Emissionen 2024 deutlich geringer ausfallen. Aus Gründen der Konsistenz wurden die ermittelten Werte für die Jahre 2022 und 2023 nicht angepasst.
Tabelle 3‑8: Scope 1-Emissionen aus Prozessen der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung inkl. Klärschlammverbrennung
| Scope 1 Emissionen aus Prozessen | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| SUMME | t CO2-Äq. | 44.640 | 45.350 | 29.010 |
| Trinkwasseraufbereitung | t CO2-Äq. | 310 | 260 | 290 |
| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | - | - | - |
| CH4-Emissionen | t CO2-Äq. | 310 | 260 | 290 |
| Sielnetz | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |
| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |
| CH4-Emissionen | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |
| N2O-Emissionen | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |
| Abwasserentsorgung inkl. Klärschlammverbrennung | t CO2-Äq. | 44.330 | 45.080 | 28.720 |
| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | - | - | - |
| CH4-Emissionen | t CO2-Äq. | 4.740 | 4.740 | 4.740 |
| N2O-Emissionen | t CO2-Äq. | 39.600 | 40.350 | 23.99038 |
Tabelle 3‑9: Biogene Emissionen aus Prozessen der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung inkl. Klärschlammverbrennung
| biogene Emissionen aus Prozessen | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| SUMME | t CO2-Äq. | 176.350 | 176.320 | 174.520 |
| Trinkwasseraufbereitung | t CO2-Äq. | 1.110 | 1.140 | 1.260 |
| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | 1.110 | 1.140 | 1.260 |
| Sielnetz | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |
| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | n/a | n/a | n/a |
| Abwasserentsorgung inkl. Klärschlammverbrennung | t CO2-Äq. | 175.240 | 175.180 | 173.250 |
| CO2-Emissionen | t CO2-Äq. | 175.240 | 175.180 | 173.250 |
Durch ausschließlichen Zukauf regenerativen Stroms resultieren aus dem Strombezug nach dem marktbasierten Ansatz keine Scope 2-Emissionen, da diese mit dem Emissionsfaktor 0 kg CO2-Äq./kWh belegt sind. Um Erfolge durch Energieeinsparmaßnahmen sichtbar zu machen, sind zusätzlich die resultierenden Scope 2-Emissionen unter Berücksichtigung des standortbasierten Ansatzes mit dem Emissionsfaktor des Bundesstrommix in Tabelle 3‑10 dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass neben dem Energiebezug auch der angesetzte Emissionsfaktor über die Jahre immer geringer wird, da sich die Zusammensetzung des Bundesstrommix ändert.
Tabelle 3‑10: Scope 2, indirekte Emissionen durch den Energiebezug
| Scope 2, indirekte Emissionen durch den Energiebezug | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| marktbasierter Ansatz:
Ökostrom - gilt für HWW und HSE |
t CO2-Äq. | 0 | 0 | 0 |
| standortbasierter Ansatz HW: bundesdeutscher Strommix | t CO2-Äq. | 26.76539 | 33.66540 | 29.835 |
| standortbasierter Ansatz HWW | t CO2-Äq. | 19.790 | 25.051 | 21.930 |
| standortbasierter Ansatz HSE | t CO2-Äq. | 6.975 | 8.614 | 7.905 |
| angesetzter Emissionsfaktor (gemäß Vorgabe BUKEA Leitstelle Klimaschutz: bis einschließlich 2022 Strommix gemäß Statistikamt Nord, Wert auf Basis der Hamburger CO2-Bilanz, ab 2023 Bundesstrommix) |
kg/kWh | 0,348 | 0,442 | 0,388 |
Für ein Unternehmen wie HAMBURG WASSER mit viel Bautätigkeit und einem umfangreichen Bezug von Waren und Dienstleistungen sind auch die indirekten Emissionen aus vor- und nachgelagerten Aktivitäten des Scope 3 relevant. Gemäß Schätzungen machen die Scope 3-Emissionen mehr als 50 % der Gesamtemissionen eines Unternehmens aus. Aus diesem Grund wird HAMBURG WASSER die Berichterstattung zukünftig um Informationen zu Scope 3-Emissionen ergänzen.
2022 wurde daher zunächst eine Wesentlichkeitsanalyse41 in einem internen Workshop durchgeführt und die Ergebnisse mit einer Peer Group aus der Branche abgeglichen. Zu den drei Kategorien, die in Bezug auf das Emissionsaufkommen als besonders wesentlich identifiziert wurden, wurde durch die Peer Group eine Erhebungsmethodik42 erarbeitet. Auf Grundlage dieser Methodik werden für das Jahr 2023 erstmals Scope 3-Emissionen für die Kategorien Eingekaufte Waren und Dienstleistungen (Scope 3.1), Investitionsgüter (Scope 3.2) und Abfälle (Scope 3.5) berechnet. Zusätzlich erfolgt eine Erhebung für die Kategorien Geschäftsreisen (Scope 3.6) und Pendeln der Mitarbeitenden (Scope 3.7). Die erhobenen Daten werden mit Veröffentlichung des Klimaschutzplans von HAMBURG WASSER im Jahr 2025 veröffentlicht.
HAMBURG WASSER verfolgt seit 1997 eigene Projekte der regenerativen Erzeugung von Strom- und Wärmeenergie. Dazu zählen der Betrieb von Windenergie- und Photovoltaikanlagen, die Faulgasaufbereitung und Klärschlammverbrennung. Die regenerativ erzeugte Energie wird zunächst zur Deckung eigener Verbräuche verwendet, sodass das Klärwerk bereits im Jahr 2011 seinen Bedarf an elektrischer und thermischer Energie bilanziell vollständig aus eigener, regenerativer Produktion erreicht hat.
Von 2020 bis 2023 hat HAMBURG WASSER 16,5 Mio. Euro in den Kauf sowie Bau von Windenergie- und Photovoltaikanlagen beim Klärwerk Dradenau und weitere 14,5 Mio. Euro in den Umbau der biologischen Abwasserbehandlung des Klärwerks von einer Oberflächen- auf eine Druckbelüftung investiert. Damit kann der Stromverbrauch dieses Anlagenteils um rund die Hälfte reduziert werden. Im Jahr 2024 wurden weitere Projekte im Bereich Photovoltaik umgesetzt, darunter eine Anlage an der Druckerhöhungsstation Roggenhorst mit einer Leistung von 99kWp. In den nächsten Jahren soll der Ausbau von Photovoltaikanlagen an den Standorten weiter gesteigert werden.
Zusätzlich werden im Zeitraum 2021 bis 2029 insgesamt 84 Mio. Euro in die Erweiterung der Faulung investiert. Neben den daraus gesteigerten Kapazitäten zum anaeroben Klärschlammabbau kann zusätzlich die Biomethanproduktion um rund 42 % gesteigert werden.
Tabelle 3‑11: Handabdruck von HAMBURG WASSER durch die Einspeisung regenerativer Energie
| Handabdruck, Einspeisung regenerativer Energie43 | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| SUMME | t CO2-Äq. | - 15.230 | - 14.410 | - 15.310 |
| HWW | t CO2-Äq. | - | - | - |
| HSE | t CO2-Äq. | - 15.230 | - 14.410 | - 15.310 |
| Einspeisung von regenerativem Strom | t CO2-Äq. | - 1.700 | - 3.250 | - 3.950 |
| HWW | t CO2-Äq. | - | - | - |
| HSE | t CO2-Äq. | - 1.700 | - 3.250 | - 3.950 |
| Einspeisung von regenerativer Wärme | t CO2-Äq. | - 520 | - 430 | - 380 |
| HWW | t CO2-Äq. | - | - | - |
| HSE | t CO2-Äq. | - 520 | - 430 | - 380 |
| Einspeisung von Biomethan | t CO2-Äq. | - 13.010 | - 10.740 | - 10.980 |
| HWW | t CO2-Äq. | - | - | - |
| HSE | t CO2-Äq. | - 13.010 | - 10.740 | - 10.980 |
Der überschüssige Teil der regenerativ erzeugten Energie wird an Dritte verkauft bzw. in Form von Strom, Biomethan und Wärme in externe Netze eingespeist44. Mit der Abgabe/dem Verkauf CO2-frei erzeugter, regenerativer Energie an Dritte ist ein positiver Handabdruck45 des Unternehmens verbunden: Durch die Einspeisung wird die Energiewende vorangebraucht und CO2-Emissionen bei Dritten vermieden, die bei der Verwendung fossiler, nicht regenerativer Energien entstehen würde.
2024 hat HAMBURG WASSER durch den Verkauf und die Einspeisungen eigenerzeugter, regenerativer Energien fossile CO2-Emissionen in Höhe von 15.310 t ersetzt. In Tabelle 3‑11 ist dargestellt, in welcher Höhe CO2-Emissionen durch die Einspeisung der regenerativen Energie durch HAMBURG WASSER eingespart werden konnte. Darüber hinaus wird derzeit ein Klimaschutzplan entwickelt, der auch die übrigen Emissionen in den Blick nimmt und eine Vermeidung von Treibhausgasemissionen zum Ziel hat.
Der Bilanzierungsrahmen für die Emissionen von Luftschadstoffen umfasst die Strom- und Wärmeerzeugung, inkl. der Klärschlammverbrennung sowie den Fuhrpark. Die detaillierte Methodik kann der Umwelterklärung 2022 entnommen werden.
Die Emissionen säurebildender Luftschadstoffe von HAMBURG WASSER sind in Abbildung 3‑18 dargestellt. Ihre Reduktion ist vor allem auf die HSE zurückzuführen. Auch für HWW ist ein abnehmender Trend zu beobachten, der auf die Modernisierung der Fuhrparkflotte zurückzuführen ist.
Den größten Anteil am Rückgang der Emissionen von NOx und Rußpartikeln hat die Modernisierung des Fuhrparks. Die SO2-Emissionen sind aufgrund der Klärschlammverbrennung gesunken. Um die innerstädtische Schadstoffbelastung sowie Emissionen zu reduzieren, wurden bereichsübergreifend ca. 30 Elektrofahrräder inkl. E-Lastenfahrräder angeschafft. Der Einsatz von E-Lastenrädern zum Austausch von Wasserzählerkapseln und Hauswasserzähler wurde im Bereich Netze Wassermessung getestet und soll zukünftig eine weitere Option zur Emissions- und Schadstoffreduktion bieten.
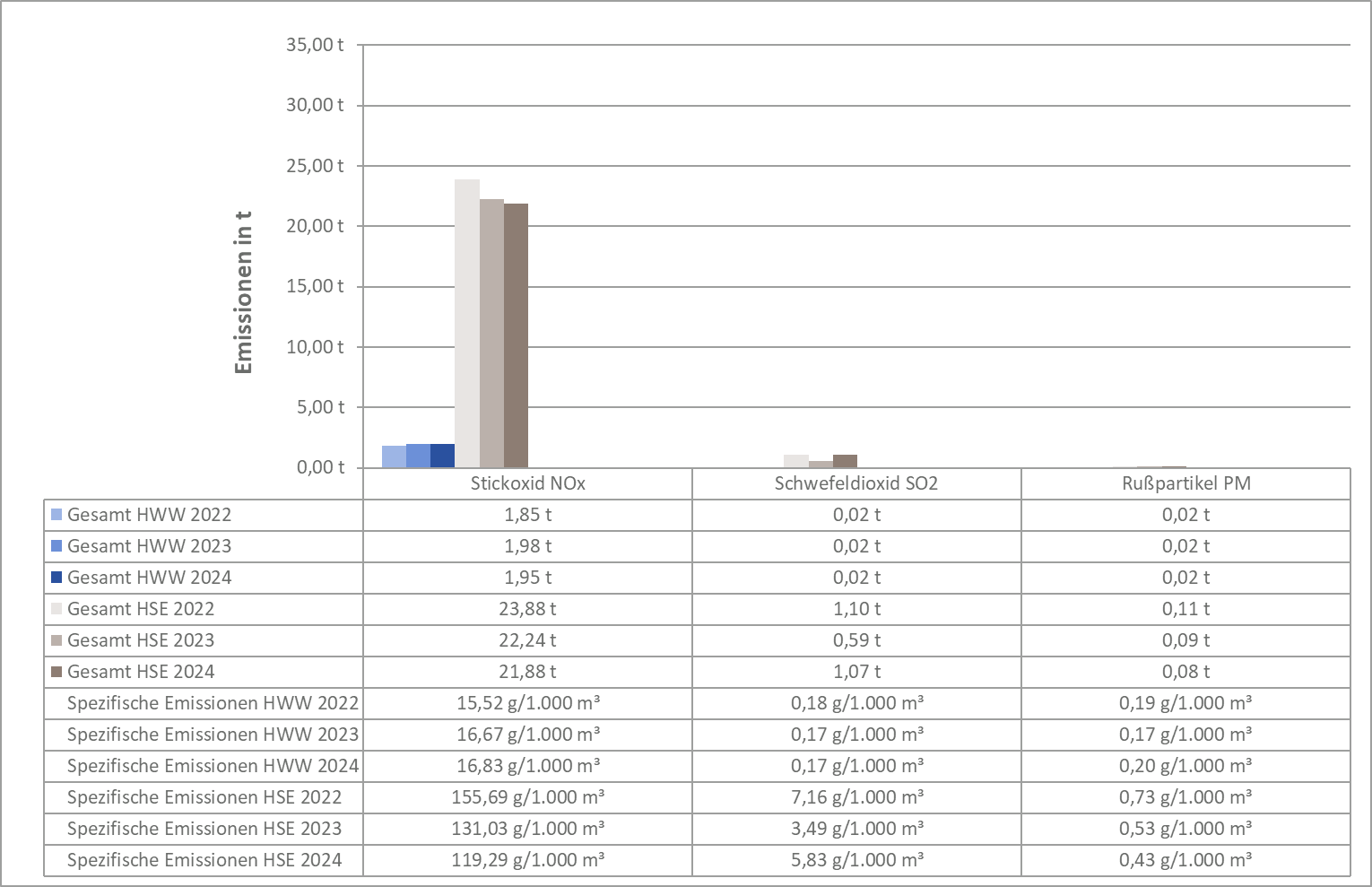
Abbildung 3‑18: Schadstoffemissionen aus dem Energieeinsatz 2024 im Vergleich zu den Vorjahren46
Die Anlage zur Klärschlammverbrennung ist nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt. Die Emissionsgrenzwerte sind in der Betriebsgenehmigung der Anlage definiert und leiten sich aus den Vorgaben der 17. BImSchV ab. Durch Aktualisierung der BVT-Schlussfolgerungen für die Abfallverbrennung (WI) wurde, zur Überführung in nationales Recht, Anfang 2024 die 17. BImSchV novelliert. Infolgedessen sind die Anforderungen an die Rauchgasreinigung und die Emissionsmessung gestiegen. In Abbildung 3‑19 und Abbildung 3‑20 sind die kontinuierlich bzw. diskontinuierlich gemessenen Emissionen der Klärschlammverbrennung als Mittelwerte des Jahres 2024 und die Genehmigungswerte angegeben. 2024 wurden im regulären Betrieb alle Emissionsgrenzwerte sicher eingehalten.
Anhang der aktuellen Emissionsdaten wird deutlich, dass die bereits seit 1997 bestehende Anlage mit einer gestuften Luftführung in der Wirbelschichtkesselanlage inklusive einer Rauchgasrezirkulation sowie einer vierstufigen Rauchgas-reinigung die beste verfügbare Technik für die Minimierung von Emissionen aus der Klärschlammverbrennung darstellt. Dieses Verfahrenskonzept wird im Zuge der Erweiterung um eine vierte Verbrennungslinie übertragen und noch weiter verfeinert.
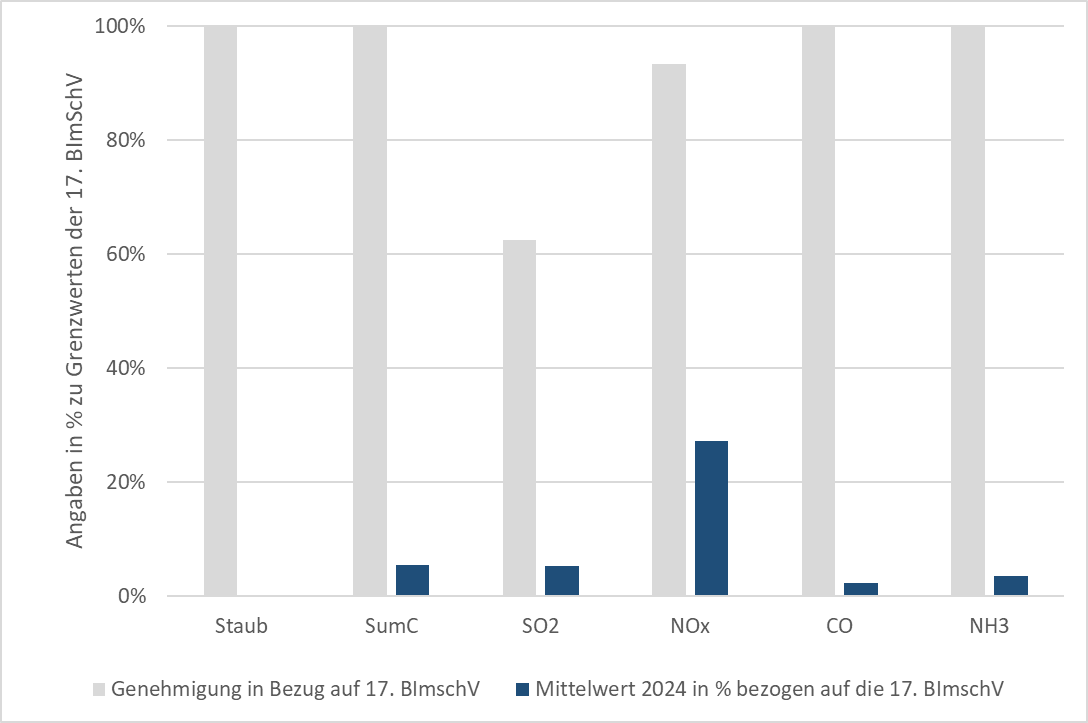 |
SumC: Gesamtkohlenstoff SO2: Schwefeldioxide NOx: Stickoxide CO: Kohlenstoffmonoxid NH3: Ammoniak |
|---|---|
Abbildung 3‑19: Kontinuierlich gemessene Emissionen Klärschlammverbrennung Mittelwerte 202447 bezogen auf die Grenzwerte der 17. BImSchV
Abbildung 3‑20: Diskontinuierlich gemessene Emissionen Klärschlammverbrennung Mittelwerte 2024 bezogen auf die Grenzwerte der 17. BImSchV
Der leicht gesunkene Verbrauch an Dieselkraftstoff und die vermehrte Anschaffung von emissionsärmeren Fahrzeugen spiegelt sich in einer Reduktion der Schadstoffemissionen des Fuhrparks wider. Die von der gesamten Fahrzeugflotte von HAMBURG WASSER verursachten Emissionen von Kohlenwasserstoffen/Stickoxiden, Kohlenstoffmonoxid und Rußpartikeln sind in Abbildung 3‑21 dargestellt. Gegenüber 2023 konnten die Emissionen von Kohlenwasserstoffen / Stickoxiden sowie von Rußpartikeln erneut gesenkt werden. Die Emissionen von Kohlenstoffmonoxid sind leicht gestiegen.
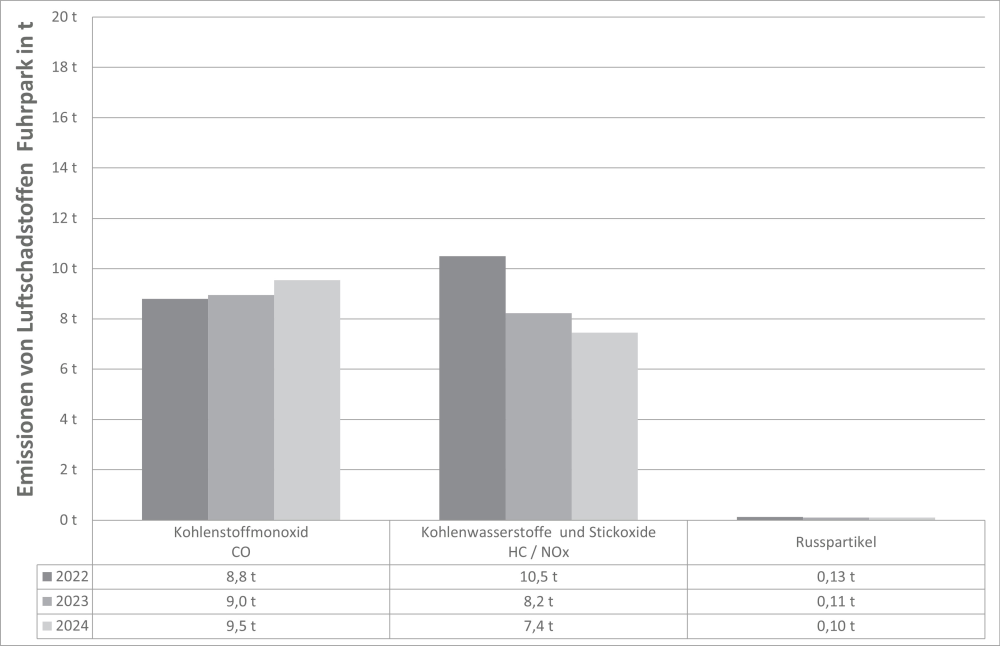
Abbildung 3‑21: Schadstoffemissionen48 des Fuhrparks HAMBURG WASSER 2024 im Vergleich zu den Vorjahren
HAMBURG WASSER verwendete 2024 keinen Rohstoff von der Liste der kritischen Rohstoffe der EU49 direkt als Bau-, Betriebs- oder Hauptverbrauchsmaterial. In IT-Komponenten sind jedoch kritische Rohstoffe enthalten, weshalb sich HAMBURG WASSER um eine Weiterverwendung noch brauchbarer Geräte bemüht. Von den 2024 ausgemusterten Geräten wurden 28% noch nicht verwertet, 43% einer Weiternutzung zugeführt und 29% der Geräte wurden entsorgt.
Der Einsatz von Bau-, Betriebs- und Hauptverbrauchsmaterialien in den unternehmenseigenen Prozessen und Anlagen von HAMBURG WASSER und der damit einhergehende Verbrauch an Rohstoffen und Ressourcen ist ein wesentlicher Umweltaspekt des Unternehmens. Es gibt verschiedene Projekte mit dem Ziel, durch die Optimierung von Prozessabläufen oder die Entwicklung von Alternativen in der Prozesstechnik die Menge der verwendeten Rohstoffe und Ressourcen zu reduzieren.
Um zukünftig den Einbau von Primärbaustoffen zu reduzieren und den Wertstoffkreislauf von Böden weiter zu forcieren, plant HAMBURG WASSER gemeinsam mit den städtischen Leitungsnetzbetreibern HEnW und Hamburger Energienetze (fusioniert aus SNH und GNH) die Errichtung einer Bodenbehandlungsanlage BONT (BOdenmanageNT-Anlage). Mit der Bodenbehandlungsanlage werden Aushubböden für den städtischen Wiedereinbau aufbereitet und werden nicht dem Stoffkreislauf entzogen, da die Deponierung von Böden reduziert wird. Derzeit ist aufgrund unterschiedlicher vergaberechtlicher Anforderungen der an BONT beteiligten städtischen Unternehmen eine direkte Inhouse-Vergabe der Bodenaufbereitung für HAMBURG WASSER nicht möglich. Die entsprechenden Randbedingungen befinden sich derzeit zwischen den städtischen Netzbetreibern in Klärung.
HAMBURG WASSER sieht sich außerdem als Vorreiter für einen aktiven Ressourcenschutz und engagiert sich über seine Tochter, die Hamburger Phosphorrecycling GmbH konsequent beim Thema Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammaschen.
Die Trinkwasseraufbereitung erfolgt bei HAMBURG WASSER überwiegend mithilfe naturnaher Verfahren. Die Mengen eingesetzter Aufbereitungschemikalien sind daher bezogen auf die produzierte Reinwassermenge sehr gering. Sie können Tabelle 3‑12 entnommen werden.
Aufgrund der sehr guten Wasserqualität kann das Trinkwasser größtenteils ohne Desinfektion in das Rohrnetz eingespeist werden. Seit 2011 ist daher nur noch in einem der sechzehn Wasserwerke und im Hauptpumpwerk Rothenburgsort eine Desinfektion erforderlich.
Tabelle 3‑12: Materialeinsatz und Gefahrstoffverbrauch bei der Trinkwasseraufbereitung und -desinfektion 2024
| Materialeinsatz | Wirkung | Einheit | 2024 |
|---|---|---|---|
| Natriumchlorit | Trinkwasserdesinfektion | t | 31 |
| Chlorgas | Trinkwasserdesinfektion | t | 9 |
| Sauerstoff | Oxidation der Wasserinhaltsstoffe Eisen und Mangan | t | 197 |
| Polyaluminiumchlorid (PAC) | Behandlung des bei der Trinkwasserproduktion anfallenden Abwassers: Verbesserung des Absetzverhaltens des Eisenschlamms | t | 25 |
Der Materialeinsatz und Gefahrstoffverbrauch bei der Abwasserableitung und -behandlung 2024 ist in Tabelle 3‑13 angegeben. Beim Transport von Abwasser über weite Fließwege kommt es unweigerlich zu Fäulnisprozessen, die unangenehme Geruchsentwicklungen mit sich bringen. Durch den Einsatz von Zusatzstoffen kann hier die Entwicklung von Geruchsbelästigungen wirksam bekämpft werden. Wenn möglich, wird eine Vermeidung von Geruchsbelästigungen durch Abluftabsaugungen angestrebt. Ziel ist es, die Dosierung von Zusatzstoffen so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund wird seit 2007 der bei der Trinkwasserproduktion anfallende Eisenschlamm im Sielnetz zur Schwefelbindung und Geruchsbekämpfung wiederverwendet.
Bei der Abwasserbehandlung wird der Großteil der Zusatzstoffe für eine verbesserte Trennung von Wasser und Schlamm eingesetzt. Flockungsmittel, Fällmittel und Flockungshilfsmittel verbessern die Ausfällung im Wasser unerwünschter Nährstoffe, wie z. B. Phosphaten, die Absetzbarkeit der Schlammflocken bzw. die Entwässerbarkeit von Schlämmen.
Tabelle 3‑13: Materialeinsatz und Gefahrstoffverbrauch bei der Abwasserableitung und -behandlung 2024
| Stoff | Wirkung | Einheit | 2024 |
|---|---|---|---|
| Wasserstoffperoxid | Vermeidung von Geruchsemissionen (Kanalnetz), Brauchwasseraufbereitung (Klärwerksverbund) | t | 10 |
| Eisen(II)-chlorid | Vermeidung von Geruchsemissionen (Kanalnetz) | t | 501 |
| NUTRIOX | Vermeidung von Geruchsemissionen (Kanalnetz) | t | 37 |
| Polyaluminiumchlorid (PAC) | Verbesserung der Belebtschlammflocke (Klärwerk Dradenau) | t | 1.374 |
| Eisen(II)-sulfat | Phosphatfällung (Klärwerk Köhlbrandhöft) | t | 7.788 |
| Flockungshilfsmittel | Verbesserung der Entwässerbarkeit von Schlämmen (Klärwerk Köhlbrandhöft) | t | 1.100 |
In der Klärschlammverbrennung werden Chemikalien insbesondere für die Reinigung des Rauchgases und der Filter sowie die Regeneration der Ionentauscher benötigt. Dadurch können die Emissionen, die in die Umwelt gelangen, so gering wie möglich gehalten werden. Die Chemikalien mit den größten Einsatzmengen sind in Tabelle 3‑14 zusammengefasst.
Tabelle 3‑14: Materialeinsatz und Gefahrstoffverbrauch bei der Klärschlammverbrennung 2024
| Stoff | Wirkung | Einheit | 2024 |
|---|---|---|---|
| Natronlauge 50% | Regeneration der Ionenaustauscher | t | 43 |
| Salzsäure 31% | Regeneration der Ionenaustauscher | t | 39 |
| Calciumdihydrat | Schadstoffadsorption aus den Gewebefiltern (zwischen SO2-Wäscher und Kamin) in Verbindung mit Aktivkohle | t | 190 |
| Amersep MP3 | Chelatbildner zur Entfernung von Schwermetallen in der nassen Rauchgasreinigung | t | 2 |
| Abwasserreinigungsmittel | Mittel zur Schwermetallfällung in der Abwasseraufbereitung | t | 1,1 |
| Ammoniaklösung 25% | Konditionierungs- bzw. Konservierungsmittel für Kondensat gefüllte Rohrleitungen | t | 1,2 |
| Eisen-III-Chlorid-Lösung 40% | Flockungsmittel zur Bildung von Mikroflocken im Abwasserreaktionsbehälter vor Kammerfilterpresse | t | 0,5 |
Ein weiteres zentrales Betätigungsfeld von HAMBURG WASSER ist die Unterhaltung des Trinkwasserrohrnetzes und der Abwassersiele. Im Trinkwasserbereich werden dafür insbesondere Gussrohre und Armaturen benötigt. Im Abwasserbereich werden Bau- und Unterhaltungsarbeiten in der Regel fremdvergeben. Hauptverbrauchsmaterialien der HSE sind Schächte und Schachtabdeckungen.
Wertstoffe und Abfälle entstehen bei HAMBURG WASSER überall da, wo Rohstoffe und Ressourcen eingesetzt werden: In der Trinkwasserproduktion, bei der Abwasserableitung und -behandlung, bei der Klärschlammverbrennung sowie im Zuge von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken und Leitungen. Ebenso bei den Verwaltungsarbeiten und Kundenservicecentern fallen Abfälle an, hauptsächlich in Form von haushaltsähnlichen Abfällen wie Pappe und Papier, Kunststoffen, Bioabfällen und Restmüll.
Der Transport, die Lagerung, die Trennung und die Entsorgung von Abfällen können Auswirkungen auf die Umwelt haben. HAMBURG WASSER hat insgesamt 13 Umweltaspekte im Themenfeld Entsorgung & Recycling als wesentlich eingestuft. Mit der 2019 angestoßenen Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) und der seit 01.08.2023 gültigen Mantelverordnung inkl. Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) wird der Fokus unterstützt durch die Gesetzgebung insgesamt vermehrt auf eine verbesserte Kreislaufschließung durch die Vermeidung und die Verwertung von Abfällen gelegt. Diese Schwerpunktsetzung steht in Einklang mit dem Anspruch des Unternehmens HAMBURG WASSER Ressourcen nachhaltig zu nutzen.
Abfälle werden gemäß KrWG nach gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen differenziert. Das Abfallaufkommen der gefährlichen Abfälle betrug 2024 unter Berücksichtigung der gefährlichen Bauabfälle und der gefährlichen Abfälle aus der Klärschlammverbrennung 20.594 t. Letztere machen dabei den größten Anteil aus mit einem Anteil von 71 % der ausgewiesenen Abfälle von HAMBURG WASSER. Abfälle, wie bspw. an Subunternehmer vergebene Baumaßnahmen, deren Entsorgung in die Hände Dritter gegeben wurde, sind nicht in der Abfallbilanz enthalten.
In Abbildung 3‑22 sind die 2024 bei HAMBURG WASSER angefallenen Abfälle und ihre jeweiligen Verwertungsquoten im Vergleich zu den Vorjahren in folgenden Kategorien zusammengefasst:
Baumaterialien ungefährlich: Bauschutt, Bitumengemische,
Kunststoffe, Holz, Kies, Boden, Steine, Dämmmaterial, Beton und
gemischte BauabfälleBaumaterialien gefährlich: teerhaltiger
Straßenaufbruch, Boden, gemischte Baustellenabfälle und andere
Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthaltenAbfälle
Klärschlammverbrennung gefährlich: Kesselasche, Filterstaub,
SchwermetallschlammMetallschrott: Eisen, Stahl, Kupfer,
Messing, Blei, AluminiumSonstige ungefährliche Abfälle:
Küchenabfall (Speiseöle und -fette), biologisch abbaubarer Abfall,
Sperrmüll, Verpackungen, Kunststoffe, Altreifen, Kabel, Altpapier,
Datenschutzpapier, Glas, Restmüll, BiomüllSonstige gefährliche
Abfälle: Säuren, Lösungsmittel, Lacke, weitere Chemikalien,
Maschinen- und Hydrauliköle, Schlämme und feste Abfälle aus Leichtstoff-
und Ölabscheidern, Leuchtstoffröhren, Spraydosen, Verpackungen mit
Rückständen gefährlicher Stoffe, Strahlmittel, gebrauchte elektronische
Geräte mit darin enthaltenen gefährlichen Bauteilen sowie Batterien
Abbildung 3‑22: Abfallmengen und Verwertungsquoten HAMBURG WASSER
2024 im Vergleich zu den Vorjahren50, 51, 52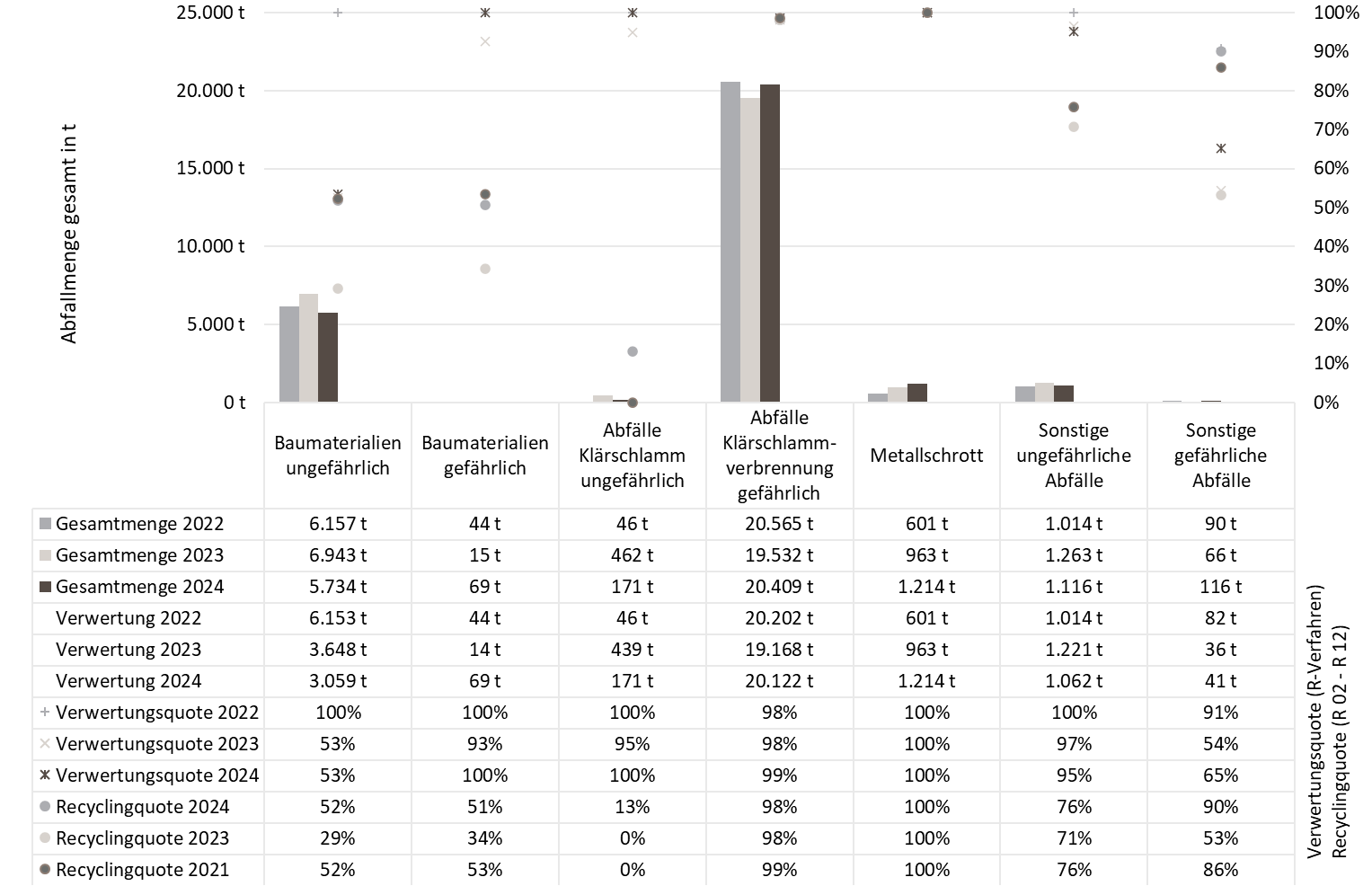
Es ist der Anspruch von HAMBURG WASSER Abfälle entsprechend der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft soweit möglich zu vermeiden und unvermeidbare Abfälle so weit wie möglich hochwertigen Verwertungsverfahren zuzuführen (R-Verfahren nach KrWG, Anlage 2). Seit Ende 2021 wird auch in den Verwaltungsstandorten eine verbesserte Abfalltrennung umgesetzt. Bei gefährlichen Abfällen ist ein Recycling in der Regel schwerer darstellbar. Dabei hängt die Verwertungsquote von der Art und Menge der anfallenden Abfälle sowie von zur Verfügung stehenden Verfahren ab. Ende 2020 konnte die Entsorgung eines Großteils der gefährlichen Abfälle aus der Klärschlammverbrennung auf ein Verwertungsverfahren (R01-R12) umgestellt werden, 2024 waren das 100% der gefährlichen Klärschlammasche. Die Klärschlammasche wird mittels Konditionierung umgewandelt und als Baustoff auf Deponien verwendet.
Baumaterialien ungefährlich: Die Fraktion Boden und Steine hat einen großen Einfluss auf die Kennzahlenbildung. In Rücksprache mit den Entsorgern hat sich gezeigt, dass in der Rohrbruchphase (Frostphase - i.d.R. November bis März) der Boden aufgrund der Beschaffenheit i.d.R. nicht verwertbar ist. Daher muss der Boden in dieser Zeit abgelagert werden. Dies wurde erstmalig in der Bilanz für 2023 berücksichtigt und wurde 2024 weiter fortgesetzt
In Anbetracht der Mindermengen bei Baumaterialien gefährlich und sonstigen gefährlichen Abfällen kann kein Trend für die Entwicklung der Verwertungs- und Recyclingquote festgestellt werden.
Zusätzlich zu den oben genannten Abfällen fallen weitere, für die Arbeit als Wasserversorger spezifische, Rückstände in der Trinkwasserproduktion an. Größtenteils handelt es sich dabei um eisen- und manganhaltigen Schlamm aus der Wasseraufbereitung. In Abbildung 3‑23 sind die vom Filterrückspülwasser separierten Schlammmengen dargestellt.
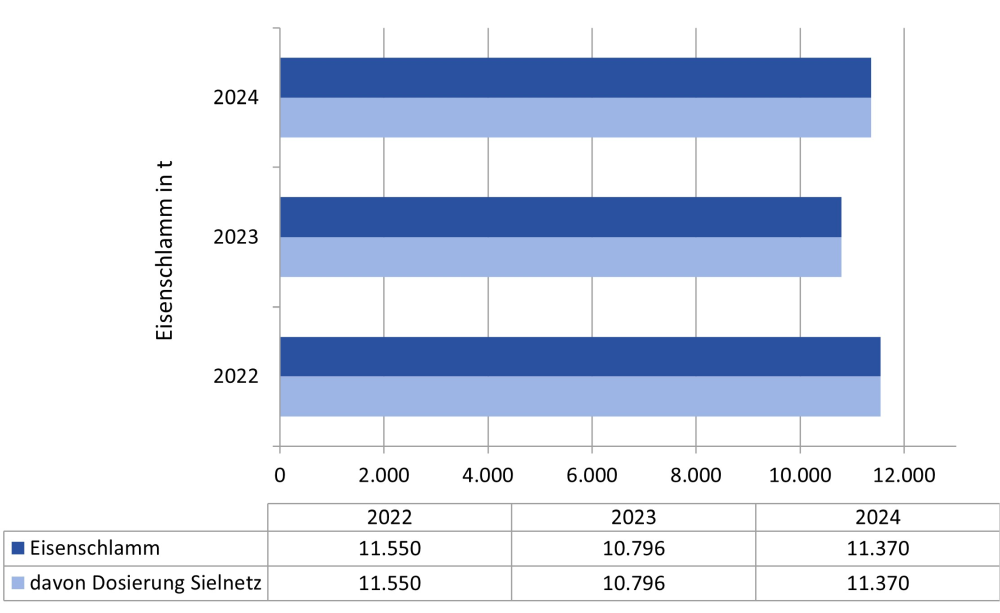
Abbildung 3‑23: Eisenschlämme aus der Trinkwasseraufbereitung 2024 im Vergleich zu den Vorjahren
Die eisenhaltigen Schlämme wurden auch 2024 zu 100% zur Geruchsbekämpfung im Sielnetz eingesetzt. Durch die Dosierung der Schlämme wird vor allem an Endpunkten von Druckrohrleitungen des Abwassernetzes die Geruchsbelästigung durch Ausgasungen von Schwefelwasserstoff unterbunden.
Zusätzlich zu den oben genannten Abfällen fallen weitere, für die Arbeit als Abwasserentsorger spezifische, Rückstände an. Bei den Rückständen aus der Abwasserableitung handelt es sich um sogenanntes Siel- und Trummengut, welches bei der Reinigung der Abwassersiele und der Straßeneinläufe (in Hamburg als Trummen bezeichnet) anfällt. Bei der Abwasserreinigung fallen Rechengut, Sandfangrückstände und Klärschlamm an. Die genaue Aufteilung kann Abbildung 3‑24 entnommen werden.
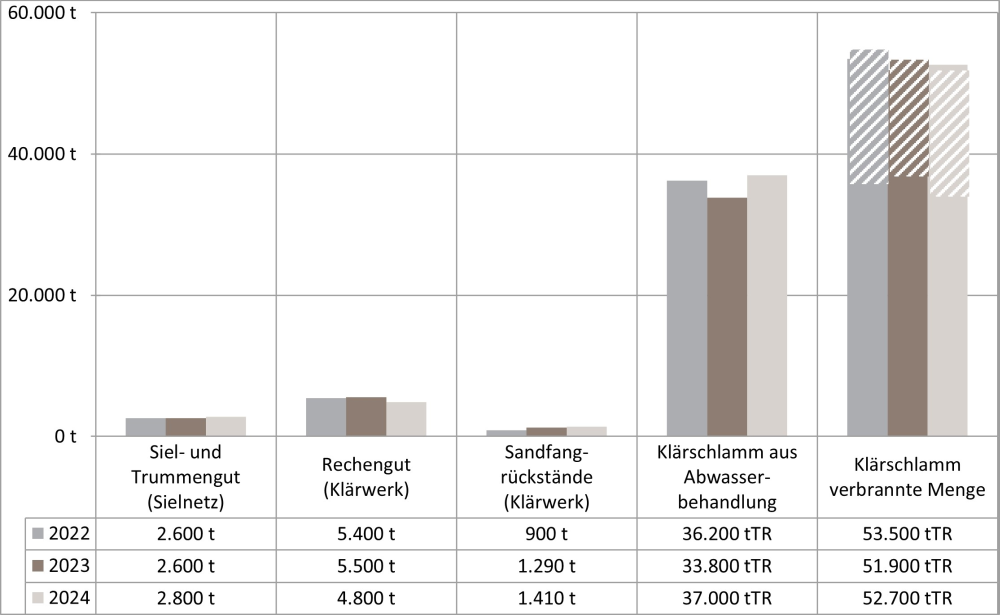
Abbildung 3‑24: Rückstände aus der Abwasserableitung und -reinigung 2024 im Vergleich zu den Vorjahren53 - zusätzlich zur Verbrennung angenommene Mengen sind schraffiert dargestellt
Das Siel- und Trummengut sowie die Sandfangrückstände werden von externen Partnern aufbereitet. Nach der Ausfaulung, Trocknung und thermischen Verwertung des Klärschlamms (plus Rechengut sowie plus extern angenommenen Co-Substraten) resultieren daraus 52700 t Trockenmasse Klärschlamm. Nach der Verbrennung bleiben dann noch 20.100 t staubige Asche übrig, welche seit Ende 2020 in zertifizierten Behandlungsanlagen aufbereitet und als Baustoff auf zwei Deponien verwertet werden.
Das Tochterunternehmen Hamburger Phosphorrecycling GmbH nimmt aktuell auf dem Gelände des Klärwerk Hamburgs eine Anlage zur Rückgewinnung des Phosphors aus Klärschlammasche in Betrieb. Mit dem Recyclingverfahren wird das wichtige Element Phosphor aus der Asche herausgeholt und zur Phosphorsäure veredelt. Als Nebenprodukte des Recyclingverfahrens werden Gips und „Metallsalze” gewonnen.
HAMBURG WASSER informiert vielfältig über die Grundlagen der Trinkwassergewinnung und naturnahen Aufbereitung sowie über die Abwasserentsorgung, Regenwassermanagement, Gewässer- und Ressourcenschutz sowie ein gewässerschonendes Konsumverhalten. Das Informationsangebot reicht von der Bereitstellung von Publikationen und Informationsbroschüren, der Information über die Internetseite54 bis hin zum persönlichen Kontakt mit der Kundschaft im Kundencenter am Ballindamm. 2024 konnten zahlreiche Kommunikationskampagnen mit Umweltbezug veröffentlicht werden, flankiert durch Presseaktivitäten und Social-Media-Kanäle.
Bei Baustellen oder Rohrbrüchen erfolgt eine umfängliche Information der Öffentlichkeit über diese „abnormalen Betriebszustände” und die damit verbundenen Auswirkungen für die Menschen.
Für die interessierte Öffentlichkeit und Schulen gibt es darüber hinaus weitere Angebote. Dazu zählen die Information über die Historie der Wasserver- und Abwasserentsorgung im WasserForum oder auf der Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe, Bildungsangebote, Auftritte auf Fachmessen und umfängliche Fachkommunikation.
Im Gebäude des ehemaligen Pumpwerk 2 des Hauptpumpwerks Rothenburgsort zeigt das WasserForum Norddeutschlands größte Ausstellung zur Wasserver- und Abwasserentsorgung. 2023 ist das Forum aufwendig neugestaltet worden. Einzelne Stationen, die sogenannten Kojen oder auch Kabinen, erzählen in chronologischer Anordnung Geschichte und Geschichten Hamburgs, darunter das Wirken des britischen Ingenieurs William Lindley, die Suche nach Grundwasser, die Hamburger Wasserwerke in den Jahren des Nationalsozialismus und der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Umweltraum findet kontinuierlich Wissenstransfer für Kitas und Schulen im Rahmen von angeleiteten, altersgerechten Bildungsangeboten und Mitmachaktionen statt.
Die Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe im Südosten von Hamburg ist heute Industriedenkmal, Museum, Tagungszentrum und Naturerlebnispfad zugleich. Eine Vielzahl an Führungen und ein breit angelegtes pädagogisches Programm bilden den Rahmen der Stiftungsarbeit vor Ort. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, neben einem aktiv betriebenen Natur- und Umweltschutz, insbesondere die Bildung in Hinblick auf die Stärkung des allgemeinen Bewusstseins für die Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung zu fördern.
HAMBURG WASSER partizipiert im Umweltbereich an Partnerschaften, welche von der Freien und Hansestadt Hamburg initiiert sind. Dazu zählt insbesondere die UmweltPartnerschaft. 2021 wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der BUKEA unterzeichnet, die die Umsetzung von gemeinsamen Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz beinhaltet. Der Fortschritt der Maßnahmen ist Inhalt regelmäßiger Gespräche zwischen der BUKEA und HAMBURG WASSER. Durch die jährlich erbrachten Leistungen zur Förderung des Umweltschutzes, der nachhaltigen Mobilität und des Klimaschutzes unterstützt HAMBURG WASSER im Rahmen dieser Partnerschaft und Vereinbarung die Ziele der Freien und Hansestadt Hamburg.
Die Mitarbeitenden werden kontinuierlich über das Intranet und das Magazin „Aquarius” informiert. Im Intranet werden Berichte wie Wasserreport, Umwelterklärung oder die neue Starkregengefahrenkarte intern veröffentlicht und Bereiche berichten regelmäßig über ihre wichtigsten Kennzahlen. Im Aquarius werden Highlights wie die Errichtung der neuen Windenergieanlage auf Dradenau oder die Aktivitäten im Rahmen von RISA zum Umbau von Hamburg als Schwammstadt zur Anpassung an den Klimawandel thematisiert. Die Veröffentlichung des Mitarbeitermagazins „Aquarius” pausierte 2024 und wird im Frühjahr 2025 mit frischen Inhalten und neuem Design wieder an den Start gehen.
In den nachfolgenden Tabellen wird zum einen die Auswertung des Umweltprogramms des Jahres 2024 und darin die Zielerreichung der bis zum 31.12.2024 formulierten Umweltziele von HAMBURG WASSER dargestellt. Zum anderen sind im Umweltprogramm 2025 die neuen Umweltziele ab 01.01.2025 sowie alle aus dem Vorjahr fortgeführten Umweltziele dargestellt.
Der Umsetzungsstand der Maßnahmen (Bearbeitungsstand vom 31.12.2024) wird in folgende Bearbeitungsstände unterteilt.
| Maßnahme umgesetzt, (Jahres-) Zielwert55 erreicht. | |
|---|---|
| Maßnahme umgesetzt, (Jahres-) Zielwert56 weitestgehend erreicht. | |
| Maßnahme umgesetzt, (Jahres-) Zielwert nicht erreicht. | |
| Maßnahme verzögert57. |
Die Zielerreichung aller 95 Umweltziele, die bis Ende 2024 terminiert waren oder ein Jahresziel hatten, ist in Abbildung 4‑1 zusammenfassend ausgewertet. Für das Umweltprogramm 2025 wurden 100 Umweltziele formuliert.
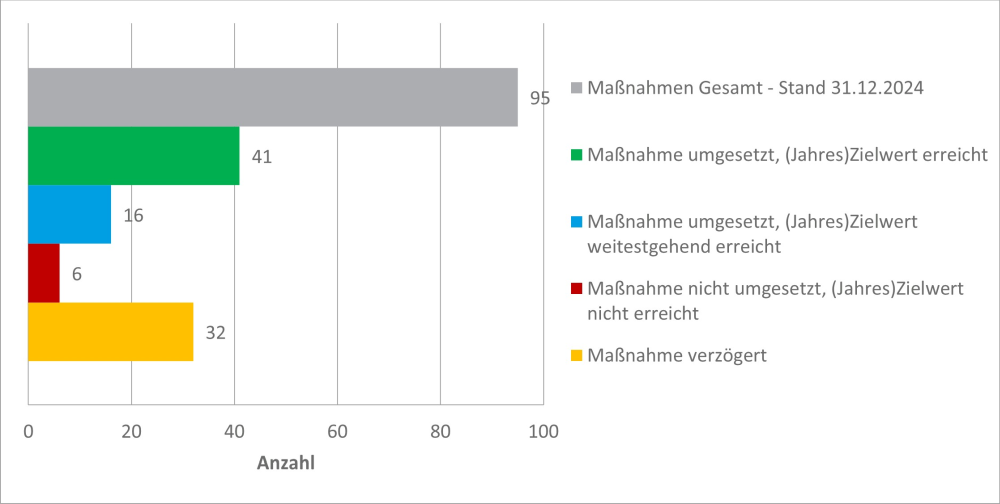
Abbildung 4‑1: Zielerreichung für das Umweltprogramm 2024 (Umsetzungstermin 31.12.2024)
Alle verzögerten, nach 2024 terminierten sowie neuen Umweltziele werden in das aktuelle Umweltprogramm 2025 aufgenommen und bis zur vollständigen Umsetzung durch die verantwortlichen Organisationseinheiten fortgeführt (teilweise mit geändertem Soll-Termin).
| Maßnahme mit Umsetzungstermin nach dem 31.12.2024, die fortgeführt wird. Für die Zielerreichung erfolgt eine Zuordnung zu den vier vorgenannten Kategorien | |
|---|---|
| In diesem Jahr neu in das Umweltprogramm aufgenommene Umweltziele und fortgeführte Ziele mit neuem Zielwert oder neuen Maßnahmen |
Die vollständigen Namen der Standorte, die in den folgenden Tabellen aufgeführt sind, finden sich in Anhang 1.
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, verantwortliche OE, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 . 1 | Ressourcenschonende Grundwasserentnahme: Kein Anstieg der Salzkonzentrationen im Rohwasser | 5-jährliche Überprüfung der Dargebotszahlen durch Erstellung der Grundwasserdargebotsstudie | Aktualisierung der Grundwasserdargebotsstudie | W14, Soll-Termin: 2027 | |
| Überwachung der Chlorid-Konzentrationen und Anpassung der Förderkonzepte bei nachhaltigem steigendem Trend | Trend der Ganglinie der Chlorid-Konzentrationen Null oder fallend | WW LAN, WW SNL, WW CUR; W14, Soll-Termin: 2024 | |||
| 1 . 2 | Hinwirken auf die Umsetzung der Vorgaben der neuen Düngeverordnung (DüV) in den landwirtschaftlichen Kooperationen | Hinwirken auf die Umsetzung der Vorgaben der neuen Düngeverordnung (DüV) in den landwirtschaftlichen Kooperationen. Die gültige Nivellierung wurde in die Beratungstätigkeit aufgenommen. | Umfassende Einhaltung der Vorgaben der DüV | WW BAU, WW CUR, WW GLI, WW HAM, WW LAN, WW NHE, WW SEM; W14, Soll-Termin: 2027 | |
| Erhöhung der Vitalität eines Moores | Erhöhung der Vitalität eines Moores durch Blockierung von Drainagegräben, Unterbindung von Nährstoffeinträgen durch zufließende Gerinne, Monitoring | Wasserhaushalt des Heidemoores ist im Rahmen der witterungsbedingten Schwankungen stabil | WW NHE; Soll-Termin: 2025 | ||
| 1 . 3 | Aktualisierung der Emissionspotenzialkarte für Niederschlagswassereinleitungen in Gewässer | Aktualisierung der Emissionspotentialkarte zur Anpassung an die Aktualisierung des Regelwerks (DWA A 102) zur Abschätzung der Emissionen aus Niederschlagsabflüssen sowie zur Abstimmung und Priorisierung von Behandlungsmaßnahmen für ganz Hamburg | Aktualisierung der Karte begonnen | Regensielnetz von HW innerhalb der FHH; E1, Soll-Termin: 2025 | |
| Identifikation und Anstoß der Umsetzung von Abkopplungs- oder Mitbenutzungsprojekten zum Rückhalt von Niederschlagswasser zur Förderung des naturnahen Wasserhaushalts und Schutz der Oberflächengewässer | Untersuchung von Abkopplungspotenzialen sowie von Möglichkeiten der multifunktionalen Flächennutzungen, insb. in überflutungsgefährdenden Gebieten sowie an der Grenze zwischen Trenn- und Mischsystem und für Gebiete mit Multiplikator-Wirkung | Ein Projekt im größeren Maßstab pro Jahr | Einzugsgebiet Sielnetz HW; E1, Soll-Termin: 2025 | ||
| 1 . 4 | Gewässerschutz: Sicherstellung einer hohen Frachtreduktion |
Sicherstellung einer hohen Frachtreduktion mit dem Ziel der Energiereduzierung bei gleichzeitiger Prozessstabilität durch Anpassung der Fahrweise in der Phosphorelimination. | Verbesserung des in die Elbe eingeleiteten, behandelten Abwassers CSB 94% Stickstoff 83% Phosphor 92% |
Klärwerksverbund; W5, Soll-Termin: 2024 | |
| Erstellung eines Konzepts zur Verbesserung der P-Elimination | Erstellung eines Konzepts | Klärwerksverbund; W51, Soll-Termin: 2024 | |||
| 1 . 5 | Minimal Emission - Einhaltung der Gewässerschutzziele unter zunehmenden Umweltbelastungen durch Reduzierung der Oberflächenabflüsse und einer vorausschauenden und optimierten Bewirtschaftung vorhandener Speicherbauwerke | Vorhandene Simulationsmodelle werden bis Ende 2023 an Echtzeit-Regenradardaten und Echtzeitmessdaten angebunden und kalibriert. 2024 erfolgt die Anbindung an die bereits bestehende Regenprognose. Dadurch können Gewässerbelastungen frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen vorausberechnet werden. | Weniger als 10% Abweichungen der mittleren, langjährigen Gewässerbelastungen gegenüber Zielwerten | Einzugsgebiet Sielnetz HW; E03, Soll-Termin: 2024" |
|
| Gewässerschutz - Entlastung der Gewässer | Wir achten darauf, dass nichts in unsere Netze kommt, was nicht da
hineingehört und alles nur an den dafür vorgesehenen Stellen wieder
austritt. Durchführung der regelmäßigen Wartungs- und Inspektionsarbeiten. Gut funktionierendes System von Rufbereitschaften. Regelmäßige Überprüfung des Leitsystems, Absicherung des Leitsystems durch Redundanzen Intensive Schulung der Netzsteuerung. |
0 - "Keine" betriebsbedingte Überstauungen oder Überläufe in Gewässer | Netze; N 2 - 3, N 6, Soll-Termin: fortlaufend" |
||
| Wir achten darauf, dass nichts in unsere Netze kommt, was nicht da
hineingehört und alles nur an den dafür vorgesehenen Stellen wieder
austritt. Regelmäßige optische Inspektion der Siele Test eines kabelgebundenen Verfahrens zur Identifikation von Fremd- oder Drainagewassereinleitungen |
Identifikation von mindestens 20 unsachgemäßen Einleitungen pro Jahr. | Netze; N 2 - 3, N 6, Soll-Termin: fortlaufend" |
|||
| 1 . 8 | Id entifikation von gesetzlich geschützten Biotopen gemäß §30 Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG auf HW Liegenschaften | 1. zentrale Dokumentation der für HW relevanten Informationen zu diesem Thema anlegen (Q 11 Umweltmanagement) 2. GIS Analyse durchführen: Verschneidung der Biotopkartierung mit den HW Liegenschaften um Betroffenheitspotential abzuleiten (IK1) 3. Ableitung von ersten grundsätzlichen Empfehlungen an die betroffenen Fachbereiche basierend auf den Erkenntnissen aus Dokumentationssammlung und GIS Analyse (Q 11, E 1) |
Ableitung von ersten grundlegenden Empfehlungen: Welche Vorgaben des BNatSchG müssen bei Biotopen beachtet werden? - Weitergabe von Informationen im Rahmen der Umweltbetriebsprüfungen. |
Unternehmen HW; Q 11 in Unterstützung mit E 1, Soll-Termin: 2024 | |
| Ökologischere Nutzung von Eigentumsflächen | Untersuchung von Eigentumsflächen auf die Möglichkeit Blühflächen anzulegen | Alle genannten Standorte sind auf die Möglichkeit Blühflächen anzulegen untersucht worden | Hauentwiete, Wellingsbüttel, Parzellen Björnsonweg/Brinkstücken; T02, Soll-Termin: 2024 |
||
| 1 . 9 | Schutz des Grundwassers durch Einsatz von ölfreien Transformatoren in Gewinnungsgebieten | Rückbau der vier Öltrafos und Ersatz durch Trockentrafos schaffen. | Zielwert: Austausch von vier Öltrafos, welche durch Trockentrafos ersetzt werden. | WW GLI; W23, Soll-Termin: 2025 | |
| Ersatz von Öltransformatoren durch ölfreie Transformatoren in den Brunnenfassungen | 12 Öltransformatoren durch ölfreie Modelle ersetzen. | WW NHE; W41/I2, Soll-Termin: 2026 | |||
| Tausch von Öl-Trafos (nach Variantenvergleich) | Ersatz von einem Öltransformator | WW STE; W31/I21, Soll-Termin: 2025 | |||
| Substitution von wasser gefährdenden Flockungshilfsmitteln (FHM) | Substitution lässt sich nicht 1:1 umsetzen, es sind anlagentechnische Optimierungen der Einmischung erforderlich; es wurden Optionen identifiziert, die zur erfolgreichen Substitution führen können; diese gilt es erneut zu untersuchen | Mittelfristig soll PAC als FHM durch eine nicht wassergefährdende Alternative bei den WW ersetzt werden | WW GSE; W1, W2, Soll-Termin: 2025 58 | ||
| Erhöhung des Umweltschutzes durch die Erneuerung der PAC-Anlieferungsfläche | Erneuerung einer PAC-Anlieferungsfläche | Umsetzung der Maßnahme | WW NHE; W42/I2, Soll-Termin: 2025 | ||
| Erneuerung einer PAC-Anlieferungsfläche | Umsetzung der Maßnahme | WW BOS ; W42/I2, Sol lTermin: 2025 59 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieressourcen-schonende Grundwasserentnahme durch passgenau ausgelegte und regelbare Pumpen | Tausch von 3 U-Pumpen | Umsetzung der Maßnahme | WW STE; W322 / I23, Soll-Termin: 2024 | ||
|
Austausch der U-Pumpe im Brunnen BSNL.11 gegen eine auf den Betriebspunkt angepasste Pumpe | spez. Verbrauch in kWh/100m³ | WW SNL; W32, Soll-Termin: 2024 | ||
| Ausstattung verschiedener Brunnen mit neuen, regelbaren und hocheffizienten U-Pumpen | 12 Pumpen | WW SEM; W41/I23, Soll-Termin: 2025 | |||
| Energieressourcenschonende Abgabe durch passgenau ausgelegte und deutlich kleiner dimensionierte Reinwasserpumpe | Erneuerung der RWP 1. Pumpe geliefert und Einbau inklusive Rohführung als nächster Schritt. | Umsetzung der Maßnahme | WW SEM; W41/I23, Soll-Termin: 2024 | ||
| Energieressourcenschonende Rückspülung der Filter durch passgenau ausgelegte Spülwasserpumpen | Erneuerung Spülwasserpumpen | Umsetzung der Maßnahme | WW SEM; W41/I23, Sol l-Termin: 2024 | ||
| Einführung eines Energiedatenreportings zur standardisierten u. automatisierten Erfassung und -auswertung der Energieverbräuche | Stammdaten sammeln und abgleichen; Datenschnittstellen abstimmen Datenauswertung testen 2020: Testphase 2021: Abschluss des Projektes |
Reporting ist implementiert, Probephase begonnen | Alle Standorte, v.a. Werke u. Betriebstechnik; Q 2 in Abstimmung mit FachOEs, HE, Soll-Termin: 2025 | ||
|
Steigerung des Anteils der eigenerzeugten Energie | Planung und Installation von Photovoltaik | Steigerung der Eigenproduktion um 20% gegenüber 2019 durch diverse Maßnahmen | WW CUR; W 23/Q2, Soll-Termin: 2026 | |
|
|
Entwurfsplanung Wärmeversorgung | Zielwert: mindestens 50% Einsparung fossiler Energie (Erdgas) | S tandorte: PwH; W51, Soll-Termin: 2024 | |
| Reduktion des Energiebedarfs für Beleuchtung | Austausch der alten Gasdrucklampen durch LED-Beleuchtung auf dem Gelände, Gesamtzahl ca. 150 Stück, Reduzierung der Leistung von 80W auf 35W pro Lampe | Senkung des Energiebedarfs durch Einsatz von LED | Verwaltung R'Ort; T 2, Soll-Termin: 2025 | ||
| Reduktion des Energieeinsatzes und der CO2-Emissionen durch energetische Sanierung des Werkswohnungsbestandes | Energetische Ertüchtigung der Werks-Wohneinheiten | 60% der Werks-Wohneinheiten sind energetisch saniert | Werkswohnungen und -häuser HWW und HSE; T02, Soll-Termin: 2025 | ||
| Senkung der CO 2-Emission aus dem Wärmeverbrauch | Dämmung Geschossdecke und Dach | Verringerung der Heizlast, Einsparung CO2 Emissionen | WW GSE; W24, Soll-Termin: 2025 | ||
| Durchführung einer umfangreichen Planung zur Feststellung der erforderlichen Maßnahmen | Abschluss der Planung | WW BAU; W321 / I25, Soll-Termin: 2024 | |||
| Erneuern des Dachs des Gebäudes der Leitstelle inkl. Dämmung der Decke gegenüber dem Kaltdacht. | Umsetzung der Maßnahme | WW CUR; W23, Soll-Termin: 2024 | |||
| Ersatz Ölheizung Großensee, N.N. | Modernisierung von min. 3 Heizungsanlagen in den Wasserwerken | WW GSE; W2, W3, W4, Soll-Termin: 2025 | |||
| Hydraulischen Abgleich der Heizung durchführen | Umsetzung der Maßnahme | WW CUR; W23, Soll-Termin: 2024 | |||
| Sanierung des Bürogebäudes | Umsetzung der Maßnahme | WW CUR; W23, Soll-Termin: 2024 | |||
| Anbindung an die Fernwärmeversorgung | vermiedene Tonnen CO2 | R'Ort; T bauliche Umsetzung; Q vertragliche Umsetzung, Soll-Termin: 2025 | |||
| Vorbereitung auf die Auszeichnung des HAMBURG WASSER Rechenzentrums nach dem „Umweltzeichen für Rechenzentren” (DE-UZ 228) Blauer Engel. | Aufbau eines Energiemanagementsystems, um granulare Messungen innerhalb des HAMBURG WASSER Rechenzentrums zu ermöglichen und die Abgrenzung zu anderen Systemen zu ermöglichen. Um wiederum Transparenz in den Energieverbrauch der einzelnen Komponenten zu bringen, um diese dann energieeffizienter zu nutzen. | Ausbau der Messgeräte Strom: von 6 auf 16 Messgeräte (+10) Klima: von 1 auf 5 Messgeräte (+4)" |
R’Ort; D 3, Soll-Termin: 2025 60 | ||
|
|
Bau einer weiteren Dampfturbine in der Klärschlammverbrennungsanlage zur Energieerzeugung. | Teilziel in 2024 ist die Fertigstellung des Rohbaus und zeitgerechte Umsetzung des übrigen Baufortschritts | Klärwerk (Kö); W5, Soll-Termin: 2027 | |
| 2 . 6 | Verbesserung der e nergetischen Nutzung von Energie aus Schlämmen | Konkretisierung der Planung und Schaffen der Voraussetzungen für bauliche Maßnahmen bis 2025. Für Baubeginn 2026 und Fertigstellung 2029. | Ausbau der Faulung um 20% | Klärwerk Kö; W5, Soll-Termin: 2029 | |
| Abwärmenutzung aus Abwasser (Mach 2) | Installation von Großwärmepumpen im Abwasserablauf der Dradenau zur Nutzung der Abwasserwärme. | Entnahme von 250-300 GW/h Wärme pro Jahr. Baufertigstellung bis Ende 2025. Betrieb ab 2026. | Klärwerk Dradenau; W5, Soll-Termin: 2026 | ||
| 2 . 7 | Steigerung des Anteils der eigenerzeugten Energie | Die Dachflächen des Speicher– und Druckerhöhungssystems (SDS) Roggenhorst (ROG) sollen mit PV Anlagen ausgerüstet werden. | Erhöhung des regenerativen Anteils auf 90.000 kWh/a bei der Energieversorgung | SDS ROG; W24, Soll-Termin: 2024 | |
| Im Zuge des Neubaus der Aufbereitung im WW LAN werden PV-Anlagen errichtet | Erhöhung des regenerativen Anteils auf 400.000 kWh/a bei der Energieversorgung | WW LAN; W24, Soll-Termin: 2026 | |||
| Konzept Errichtung einer WEA am Standort Großhansdorf | Steigerung der Eigenproduktion am Standort GHA um 20% gegenüber 2019 und Errichtung von mindestens 1 WEA | WW GHA; W1, Soll-Termin: 2024 | |||
| Machbarkeit und Installation von Photovoltaik prüfen | Umsetzung der Maßnahme | WW GHA; W 24/Q2, Soll-Termin: 202661 | |||
| Erzeugung regenerativen Stroms aus PV Anlage zur direkten Verwendung im Betrieb (73.000 kWh) | Reduzierung des Energiebezugs von Energieversorgungsunternehmen. | Standorte: WW GSE; W24, Soll-Termin: 2025 | |||
| Steigerung des Anteils an eigenerzeugter Energie im Normalbetrieb; Energieautarkie bei Blackout (Szenario 72 Stunden) | Konzept und Planung zur Errichtung einer WEA und PV- Freiflächenanlage am Standort Curslack | Erhöhung des Autarkiegrads des Wasserwerkes bei Blackout auf >90% für mindestens 72 Stunden | WW CUR; W1, W2, Q2, Soll-Termin: 2027 | ||
| Konzepterstellung: Energieautarkie bei Blackout am Wasserwerk durch Kombination aus regenerativer Energie (PV und Windkraft) und Energiespeicher am Standort GHA | Erhöhung des Autarkiegrads des Wasserwerkes bei Blackout auf >90% für mindestens 72 Stunden | WW GHA; W1, W2, Q2, Soll-Termin: 202562 | |||
| Konzepterstellung: Energieautarkie bei Blackout in der Zone Süd durch Kombination verschiedener Möglichkeiten (WEA, PV, Speicher, Kabeltrassen, etc. (zu prüfen)) | Erhöhung des Autarkiegrads der Trinkwasserversorgung bei Blackout auf >90% für mindestens 72 Stunden | WW SEM, WW NHE, WW BOS, WW NEU; W1, W4, Q2, Soll-Termin: 202563 | |||
| Ausbau der regenerativen Energiequellen | Errichtung einer PV-Anlage Kö Nord, Machbarkeitsstudie einer PV-Anlage Dradenau Nachkläranlage | Ausbau von Photovoltaik | Klärwerk Kö; W5, Soll-Termin: 2026 | ||
| Errichtung einer PV-Anlage Kö Mitte (KE 12) | Ausbau von Photovoltaik | Klärwerk (Kö); W52, Soll-Termin: 2025 | |||
| Errichtung einer PV-Anlage Dradenau | Konzepterstellung einer Megawatt-PV-Anlage auf Dradenau unter Berücksichtigung der zu planenden vierten Reinigungsstufe | Klärwerk Dradenau; W5, Soll-Termin: 2025 | |||
| Errichtung WEA auf Köhlbrandhöft und Einreichung des BImSchG-Antrages | Errichtung einer weiteren WEA auf Köhlbrandhöft | Klärwerk (Kö); W5, Soll-Termin: 2025 | |||
| Steigerung der Energieversorgung mit regenerativem Strom | Prüfung der zur Sanierung anstehenden Werks-Wohneinheiten auf die Möglichkeit eine PV-Anlage zu installieren | 100% der du rchzuführenden Sanierungen werden auf die Möglichkeit geprüft, eine PV-Anlage zu installieren | Werkswohnungen und -häuser HWW und HSE; T02, Soll-Termin: 2025 | ||
Energierückgewinnung und Erzeugung erneuerbarer Energien |
V forciert und unterstützt die Umsetzung von Geothermie-Projekten, Projekten zur Abwasserwärmenutzung sowie Projekten zur Herstellung von grünem Wasserstoff und Biogas im Rahmen der externen Leistungen. | 2 Projekte pro Jahr | V1, V2, Soll-Termin: 2025 | ||
| 2 . 9 | CO2 Reduktion CO2-Emissionen des Fuhrparks verringern |
abgängige Autos durch E-Fahrzeuge ersetzen | Anteil der Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben verringern | WW GSE / WW GHA / WW LAN/ WW WAL; W24, Soll-Termin: 2030 | |
| abgängige Autos durch E-Fahrzeuge ersetzen | Anteil der Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben verringern | WW BAU, WW SNL, WW STE; W32 / T24, Soll-Termin: 2030 | |||
| Mobilitätskonzept durchführen. Auf Fahrten verzichten oder diese CO2-neutral durchführen. Reduktion des Pkw-Bestandes mit Verbrennungsmotoren | Reduktion der CO2 Emission aus Pkw-Verkehr um 5% pro Jahr | Netz betriebe; N2, N3, N4, N5, N6, Sol l-Termin: fort- | |||
| Hybride / Vollelektrische Fahrzeuge | 5 hybride bzw. vollelektrische Fahrzeuge | V 1, Soll-Termin: 2025 | |||
| Dazu bis 2025 Vergabe der Bauleistungen, zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Dienstfahrzeuge und Privatfahrzeuge der Mitarbeiter an allen HW-Standorten ohne Pi, Aus, Bill. | Beauftragungen der Bauleistungen an allen HW-Standorten ohne Pi, Aus, Bill. | Alle; T 2, Soll-Termin: 45839 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Reduzierung der Lachgasemissionen in der Zentralbehandlung Köhlbrandhöft | Durchführung der N2O-Onlinemessung in der Zentralbehandlung Köhlbrandhöft und Ableitung einer Fahrweise | Feststellung der N2O-Emissionen; Durchführung einer Messkonzeption und Entwicklung einer Fahrweise | Klärwerk (Kö); W51, Soll-Termin: 2024 | |
| 3.3 | Gewinnung von CO2 aus Faulgas als Einsatzstoff für industrielle Anwendungen oder für die Nahrungsmittel-industrie | Bau einer Verflüssigungsanlage für biogenes CO2 aus der Gasaufbereitung | Umsetzung der Maßnahme; Planung und Bau einer Verflüssigungsanlage einschließlich Lagerung für den CO2-Abgasstrom aus der Gasaufbereitungsanlage GALA II. Dieses biogene Kohlendioxid wird derzeit in die Atmosphäre entlassen und soll zukünftig stofflich genutzt werden. | Klärwerk (Kö); W52, Soll-Termin: 2026 | |
| 3.4 | Rückhalt von CO2 aus dem Rauchgas der VERA und Schutz der Gewässer vor Übersäuerung | Pilotversuche zur Abtrennung von biogenen CO2 aus den Rauchgasen der VERA / Installation und Betreuung einer Anlage in 2024 | Bestätigung der Technologie; Installation eines Versuchscontainers und Durchführung von Versuchen, mit Hilfe von Kalkstein Kohlendioxid in die Wasserphase zu überführen. | Klärwerk (Kö); W53, Soll-Termin: 2024 | |
| Vermehrte Erzeugung von regenerativer Energie durch Erniedrigung des Abdampfdruckes der Dampfturbine | Überprüfung der Umrüstung des luftgekühlten Kondensators der VERA zu einer Luft- oder Wasserkühlung zur Verbesserung der Energieausbeute | Prüfung, ob und wie die Kühlung durch Installation von Wärmetauschern in der Belebungsanlage Köhlbrandhöft Süd möglich und wirtschaftlich ist. | Klärwerk (Kö); W53, Soll-Termin: 2024 | ||
| 3.6 | CO2-Fussabdruck von 3 Leitungsbau Maßnahmen ermitteln | Nachkalkulation der Massen und Multiplikation mit den Emissionsfaktoren. Die Emissionsfaktoren müssen zuerst ermittelt werden. | Durchführung der Kalkulationen und Darstellung im Bericht. | R'Ort; I02, Soll-Termin: 2024 | |
| Konzept zur Anwendung von Recyclingbeton in den Baumaßnahmen | Expertise erarbeitet | Konzepterstellung | R'Ort; I25 / I02, Soll-Termin: 2024 | ||
| 3.9 | Reduzierung des Verbrauchs fossiler Kraftstoffe | Beschaffung eines elektrobetriebenen Lastkraftwagens für den Abfalltransport auf Köhlbrandhöft | Umsetzung der Maßnahme | Klärwerk (Kö); W53, Soll-Termin: 2024 | |
| Erweiterung der Treibhausgasbilanz um Scope 3 Emissionen | Schätzung der Scope 3 Emissionen von HAMBURG WASSER im Rahmen des Klimaschutzplans | Teilziele 2024: '1.) Scope 3 Emissionen für Scope 3.6 (z.B. Pendeln der Mitarbeitenden) ermittelt |
HW; Q1, Soll-Termin: 2024 | ||
| Senkung der Treibhaus-gasemissionen des Unternehmens | Verabschiedung eines Science Based Target im Rahmen des Klimaschutzplans auf Basis der zum Zeitpunkt der Verabschiedung verfügbaren Datengrundlage | Teilziel 2022: '1.) Verbesserung der Datengrundlage für Scope 1 und 2 Teilziel 2023: 2.) Verbesserung der Datengrundlage für Scope 3 Teilziel 2024: 3.) Verbesserung der Datengrundlage für Scope 1 - 3 Teilziel 2026: 4.) Science Based Target verabschiedet |
HW; Q13, Soll-Termin: 2026 | ||
| Durch die Nutzung des angebotenen Dienstrad-Leasings nutzen mehr Mitarbeitende das Fahrrad für An- und Abreise zum Arbeitsort. Zudem werden auch kurze dienstliche Strecken auf dem Fahrrad erledigt. Auf diese Weise werden Emissionen eingespart. | Das Leasing von Diensträdern wird finanziell unterstützt. Das Angebot wird in der Belegschaft beworben. | Nutzer Dienstrad-Leasing. Zielwert: 200 | HW; P3, Soll-Termin: 2025 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Umweltverträgliche Beschaffung | Berücksichtigung der Aspekte aus dem § 3b des Hamburgischen Vergabegesetzes - Umweltverträgliche Beschaffung von Liefer- und Dienstleistungen in allen Ausschreibungsfällen | Zielwert: 0 --> Abweichung von § 3b des Hamburgischen Vergabegesetzes - Umweltverträgliche Beschaffung von Liefer- und Dienstleistungen |
HW-Zentrale; B4, Soll-Termin: 2024 | |
| Vorbereitung auf die Auszeichnung des HAMBURGWASSER Rechenzentrums nach dem „Umweltzeichen für Rechenzentren” (DE-UZ 228) Blauer Engel. | Einführung von Einkaufs-Richtlinien für die Beschaffung von Rechenzentrums-komponenten, die besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit legen (z.B. Recyclingprogramme, Energieeffizienzklassen o.Ä.). | Zukünftig für das HAMBURG WASSER Rechenzentrum beschaffte Geräte, die ihr „End of Life” erreicht haben und noch funktionstüchtig sind, sollen durch den Hersteller wiederverwertet oder recycelt werden. Des Weiteren müssen diese Geräte mindestens die in DE-UZ 228 vorgeschriebene Energieeffizienzklasse vorweisen. Bei gleichwertigen Geräten oder Komponenten werden solche bevorzugt gekauft, deren Herstellung im Vergleich nachhaltiger ist. | Rort; D 3, Soll-Termin: 2025 | ||
| Reduktion des Papierverbrauchs | Einführung einer elektronischen Juristenakte für R1 mit dem Ziel, dass die derzeit bei R1 vorgehaltenen Papierakten abgeschafft werden können und der Konzern-rechtsberatungsprozess ausschließlich digital hinterlegt wird. | 1.) Implementierung des Software-Tools
(2022) 2.) Nutzung des Tools durch die Juristen bei R1 (fortlaufend) |
R'Ort; R11, Soll-Termin: 2024 | ||
| Betriebs- und Verbrauchs-materialien reduzieren | Senkung des Papierverbrauchs durch zunehmende Digitalisierung, Erhöhung von digitalen Prozessen- Unterstützung der digitalen Signatur | 50 % Reduzierung des Papierverbrauchs bis 2025 | R'Ort; P1 - P4, Soll-Termin: 2025 | ||
| 4.2 | Sicherer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | Prüfung der Betroffenheit der Anlagen auf den Wasserwerksstandorten durch die Anforderungen der AwSV, Ermittlung der Gefährdungsstufen und Umsetzung der Bedarfe | Detaillierte Anlagendokumentation für die AwSV-Anlagen erstellen. | Alle Wasserwerke; W2, Soll-Termin: 2025 | |
| Einsatz von Gefahrstoffen vermeiden | Analyse der Gefahrstoffnutzung und Substitution von Gefahrstoffen | Reduzierung der Anzahl von Produkten mit Gefahrstoffkenn-zeichnung gegenüber 2019 um -10 % bis 2025 | Netzbetriebe; N2, N3, N4, N5, N6, Soll-Termin: 2025 | ||
| Prüfung einer nachhaltigen und zukunftssicheren Lösung für die Lagerung von Straßenaufbruch im Netzbezirk West | Prüfung | Prüfbericht erstellen | West (N4); N101, Soll-Termin: 2024 | ||
| 4.4 | Erneuerung und Modernisierung der Dosierstation für den technischen Sauerstoff zur Minimierung des Verbrauchs | Austausch der Dosierstation | Verbrauch O2/m³ Rohwasser reduzieren | WW SNL; W323, Soll-Termin: 2024 | |
| Umweltauswirkungen der Beschaffung von Bau-, Betriebs- und Verbrauchs-materialien reduzieren. | Materialbewertung hinsichtlich Toxizität, Recyclebarkeit und Minimierung von Rückständen mit Fokus auf die Lieferkette für ausgewählte prioritäre Einsatzstoffe in Kooperation mit externen Innovationspartner, Zusammenarbeit mit externem Innovationspartner | Methodik und Vorgehen an Piloten getestet | HW; Q 11, Soll-Termin: 2024 | ||
| 4.7 | Durch die Digitalisierung von Prozessen wird der Papierverbrauch im Personalbereich gesenkt. | Der Prozess zur Beantragung von Teilzeit wird digitalisiert. | Der Prozess ist digitalisiert. Zielwert 1 | HW; P1, Soll-Termin: 2024 | |
| Der Prozess zur Anzeige einer Schwangerschaft wird digitalisiert. | Der Prozess ist digitalisiert. Zielwert 1 | HW; P2, Soll-Termin: 2024 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammanlagen | Umsetzung der Optimierungsprojekte | Das Ziel ist 2024 den Regelbetrieb der TPHH zu erreichen. | Klärwerk (Kö); W5, Soll-Termin: 2024 | |
| 5.4 | Abfallbilanz-erstellung optimierten | Einführung einer Datenbank zur unternehmensweiten Erfassung von Abfallmengen und -arten. | Ausschreibung der Datenbank | R'Ort; I02 / D35, Soll-Termin: 2024 | |
| 5.7 | Verbesserung der Abfalltrennung im Klärwerksverbund | Verbesserung der Abfalltrennung | Nennung von standortbezogenen Abfallbeauftragten; Verbesserte Umweltkommunikation z.B. mit Infoboards | Klärwerk (Kö); W5, Soll-Termin: 2024 | |
| Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfalltrennung auf den Wasserwerks-standorten | Benennung und Schulung von Abfallbeauftragten am Standort | Benennung von Abfallbeauftragten am Standort für jedes Wasserwerk | W2; W2, Soll-Termin: 2024 | ||
| Benennung und Schulung von Abfallbeauftragten am Standort | Benennung von Abfallbeauftragten am Standort für jedes Wasserwerk | Standorte: W3; W3, Soll-Termin: 2024 | |||
| Benennung und Schulung von Abfallbeauftragten am Standort | Benennung von Abfallbeauftragten am Standort für jedes Wasserwerk | Standorte: W4; W4, Soll-Termin: 2024 | |||
| Reduzierung des Abfallaufkommens und Verbesserung der Wertstofftrennung | Entwicklung eines Konzeptes zur Abfallvermeidung | Reduzierung der Restmüllmenge bis 2025 um 5 % gegenüber 2021 | Standorte: Netzbetriebe; N, Soll-Termin: 2025 | ||
| Reduktion des Papierverbrauchs | Digitale Umstellung, überall wo möglich (CRM System, Kanban Board, Angebote & Verträge digital signieren) etc. | Papierverbrauch lässt sich schwer messen, ist aber durch die Maßnahmen nachweislich erheblich reduziert worden | Standorte: R'Ort; V 1, V 2, Soll-Termin: 2025 | ||
| 5.8 | Erhöhung der Behandlungs-kapazität für Klärschlämme; Umweltgerechte Entsorgung zur thermischen Verwertung von Klärschlämmen der Städte Lübeck und Hetlingen | Bau der Erweiterung der Klärschlammverbrennung | Teilziel 2024 ist die Fertigstellung des Rohbaus und zeitgerechte Umsetzung des übrigen Baufortschritts | Standorte: Klärwerk (Kö); W5, Soll-Termin: 2027 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Basisinformationen über Wasserversorgung, Abwasser-entsorgung und Gewässer- und Ressourcenschutz und gewässer-schonendes Konsumverhalten | Monatlich eine Kommunikationsmaßnahme zum Thema Umwelt / Nachhaltigkeit, das HAMBURG WASSER als umweltfreundliches Unternehmen positioniert und der Öffentlichkeit umweltschonendes Verhalten näherbringt. Die konkreten Maßnahmen können auch auf gewässerschonendes Verhalten hinweisen. | 12 durchgeführte Kommunikations-maßnahmen | HW; U1, Soll-Termin: 2024 | |
| Information der Öffentlichkeit über wasserbewusste Stadtentwicklung | Veröffentlichung der RISA-Website mit Hinweisen zur wasserbewussten Stadtentwicklung sowie Integration der neuesten RISA-Projekte | 100% der 2024 mit der Unterstützung von HW implementierten RISA-Maßnahmen sind dokumentiert und veröffentlicht | E1, Soll-Termin: 2025 | ||
| Information und Bewusstseins-förderung der Bedeutung des integrierten Regenwasser-managements als Gemeinschafts-aufgabe | Neuauflage der RISA-Website mit Hinweisen zur wasserbewussten Stadtentwicklung. Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Integration in die Kommunikationsstrategie zu Extremwetter der FFH. | Veröffentlichung der ersten Seiten der neuen RISA-Website | E1, Soll-Termin: 2025 | ||
| 6.5 | Prozessstabilität Datenerhebung | Als interner Businesspartner mit fachlicher Verantwortung für das dezentrale Controlling aller Bereich entwickelt, erhebt und analysiert B Kennzahlen im ganzen Haus. | 6 -->Dezentrale Controller in allen Bereichen |
HW; B2, Soll-Termin: 2024 | |
| Durch den Einsatz von internen Kommunikations-kanälen werden die Mitarbeitenden über das Umweltprogramm und laufende Maßnahmen informiert und so für das Thema sensibilisiert. | Mindestens einmal pro Quartal wird ein Artikel rund um das Thema "Umweltprogramm" (z.B. im Intranet oder anderen Medien) veröffentlicht. | Veröffentlichte Beiträge: Zielwert 4 | HW; P4, Soll-Termin: 2024 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| n.w. | Senkung des Wassereigen-verbrauchs | Prüfung zum Spülwasserrecycling auf Wasserwerksstandorten | Standortspezifische Konzepte für den Umgang mit Spülwasser | u.a. WW BAU, WW CUR; W1, Soll-Termin: 2026 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | S tandorte, verant wortliche OE, Soll -Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 . 1 | Ressourc en-schonende Grundwass er-entnahme: Kein Anstieg der Salzkon zentrationen im Rohwasser | 5-jährliche Überprüfung der Dargebotszahlen durch Erstellung der Grundwasse rdargebots-studie | Zielwert: Aktualisierung der Grundwasser-d argebotsstudie | S tandorte: HW; W14, Sol l-Termin: 2027 | |
| Überwachung der Chlori d-Konzentrationen und Anpassung der Förderkonzepte bei nachhaltigem steigendem Trend | Zielwert: Trend der Ganglinie der Chlorid-K onzentrationen Null oder fallend | S tandorte: WW LAN, WW SNL, WW CUR; W14, Sol l-Termin: fo rtlaufend | |||
| 1 . 2 | Erhöhung der Vitalität eines Moores | Fortführung Monitoring mit Zielstellung Identifizierung von Maßnahmen zur Erhöhung der Vitalität eines Moores | Zielwert: Wasserhaushalt des Heidemoores ist im Rahmen der witte rungsbedingten Schwankungen stabil und Nä hrstoffeintrag minimiert | S tandorte: WW NHE; W14, Sol l-Termin: 2025 | |
| Hinwirken auf die Umsetzung der Vorgaben der neuen Dün geverordnung (DüV) in den landwirt schaftlichen Koo perationen | Hinwirken auf die Umsetzung der Vorgaben der neuen Düngeverordnung (DüV) in den lan dwirtschaftlichen Kooperationen. Die gültige Nivellierung wurde in die B eratungstätigkeit aufgenommen. | Zielwert: Möglichst umfassende Einhaltung der Vorgaben der DüV | S tandorte: WW BAU, WW CUR, WW GLI, WW HAM, WW LAN, WW NHE, WW SEM, WW STE; W14, Sol l-Termin: 2027 | ||
| 1 . 3 | Ak tualisierung der Emissionspot enzial-karte für Niedersc hlagswasser- einleitungen in Gewässer | Aktualisierung der Emissi onspotentialkarte zur Anpassung an die Aktualisierung des Regelwerks (DWA A 102) zur Abschätzung der Emissionen aus Niede rschlagsabflüssen sowie zur Abstimmung und Priorisierung von Beh andlungsmaßnahmen für ganz Hamburg | Aktualisierung der Karte begonnen | Rege nsielnetz von HW innerhalb der FHH; E1, Sol l-Termin: 2025 | |
| 1 . 4 | Id entifikation und Anstoß der Umsetzung von Abkopplungs- oder Mitbenutzu ngsprojekten zum Rückhalt von Nieders chlagswasser zur Förderung des naturnahen Was serhaushalts und Schutz der Oberfläch engewässer | Untersuchung von Abkop plungspotenzialen sowie von Möglichkeiten der multifunktionalen Flächennutzungen, insb. in überflu tungsgefährdenden Gebieten sowie an der Grenze zwischen Trenn- und Mischsystem und für Gebiete mit Mult iplikator-Wirkung | Ein Projekt im größeren Maßstab pro Jahr | Einz ugsgebiet Sielnetz HW; E1, Sol l-Termin: 2025 | |
| Gewä sserschutz: Si cherstellung einer hohen Frach treduktion |
Sicherstellung einer hohen Frachtreduktion mit dem Ziel der E nergiereduzierung bei gleichzeitiger Prozessstabilität durch Anpassung der Fahrweise in der Pho sphorelimination. | Verbesserung des in die Elbe eingeleiteten, behandelten
Abwassers CSB 94% Stickstoff 83% Phosphor 92% |
Klärwerks -verbund; W5, Sol l-Termin: 2025 | ||
| 1 . 5 | Minimal Emission - Einhaltung der Gewässe rschutzziele unter zunehmenden Umwelt -belastungen durch Reduzierung der Oberfläc hen-abflüsse und einer vora usschauenden und optimierten Bew irtschaftung vorhandener Speich erbauwerke | Vorhandene S imulationsmodelle werden bis Ende 2023 an Echtzei t-Regenradardaten und Echtzeitmessdaten angebunden und kalibriert. 2024 erfolgt die Anbindung an die bereits bestehende Regenprognose. Dadurch können Ge wässerbelastungen frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen vorausberechnet werden. | Weniger als 10% Abweichungen der mittleren, langjährigen Gewäs serbelastungen gegenüber Zielwerten | Einz ugsgebiet Sielnetz HW; E03, Sol l-Termin: 2025" |
|
| Gewä sserschutz - Entlastung der Gewässer | Wir achten darauf, dass nichts in unsere Netze kommt, was nicht da
hineingehört und alles nur an den dafür vorgesehenen Stellen wieder
austritt. Durchführung der regelmäßigen Wartungs- und Insp ektionsarbeiten. Gut funktionierendes System von Ru fbereitschaften. Regelmäßige Überprüfung des Leitsystems, Absicherung des Leitsystems durch Redundanzen Intensive Schulung der Netzsteuerung. |
0 - "Keine" be triebsbedingte Überstauungen oder Überläufe in Gewässer | Netze; N 2 - 3, N 6, Sol l-Termin: fort- laufend |
||
| Wir achten darauf, dass nichts in unsere Netze kommt, was nicht da
hineingehört und alles nur an den dafür vorgesehenen Stellen wieder
austritt. Regelmäßige optische Inspektion der Siele Test eines kabelgebundenen Verfahrens zur Identifikation von Fremd- oder Drainagew assereinleitungen |
Identifikation von mindestens 20 unsachgemäßen Einleitungen pro Jahr. | Netze; N 2 - 3, N 6, Soll-Termin: fort- laufend |
|||
| 1 . 8 | Austausch zum Thema Fläche nentwicklung und B iodiversität soll fortgeführt werden. Hier soll darauf hingewirkt werden, dass die Eige ntumsflächen und Gebäude von HW im Hinblick auf Biodiversiät und Mikroklima aufgewertet werden. | Veranstaltung einer Jährlichen Austauschrunde aller involvierten Akteure bei Hamburg Wasser zur Etablierung des Themas in der Entwicklung der HW eigenen Flächen und Integration in die Umbaumaßnhmen | Zielwert: Teams Kanal zu Biodiversität bei Hamburg Wasser schaffen und jährliches Vern etzungstreffen zum Thema Biodiversität und Fläc henentwicklung bei Hamburg Wasser organisieren | S tandorte: HW; E1, Sol l-Termin: 2026 | |
| Ö kologischere Nutzung von Eigent umsflächen | Untersuchung von Eigentumsflächen auf die Möglichkeit Blühflächen anzulegen | Zielwert: alle genannten Standorte sind auf die Möglichkeit Blühflächen anzulegen untersucht worden | S tandorte: Hau entwiete, Wellin gsbüttel, Parzellen Björns onweg/Bri nkstücken ; T02, Sol l-Termin: 2025 | ||
| 1 . 9 | Schutz des Grundwassers durch Einsatz von ölfreien Tra nsformatoren in Gewinnun gsgebieten | Rückbau der vier Öltrafos und Ersatz durch Trockentrafos schaffen | Zielwert: Prüfbericht erstellen | S tandorte: WW GLI; W31, Sol l-Termin: 2026 | |
| Tausch von zwei Öl-Trafos | Zielwert: Umsetzung der Maßnahme | S tandorte: WW SNL; W323, Sol l-Termin: 2026 | |||
| Tausch von Öl-Trafos (nach Va riantenvergleich) | Zielwert: 'V eröffentlichte Beiträge: Zielwert 4 | S tandorte: WW STE; W31 /I21/I02, Sol l-Termin: 2025 | |||
| Ersatz von Öltransformatoren durch ölfreie Transformatoren in den Brunnenfassungen | Zielwert: Zielwert: 12 Ölt ransformatoren | S tandorte: WW NHE; W343/I2, Sol l-Termin: 2026 | |||
| Tausch von Öl-Trafos (nach Va riantenvergleich) | Zielwert: Umsetzung der Maßnahme | S tandorte: WW STE; W31/I21, Sol l-Termin: 2025 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | St andorte, verantw ortliche OE, Soll- Termin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 . 1 | Ene rgieressourc en-schonende Grundwas ser-entnahme durch passgenau ausgelegte und regelbare Pumpen | Tausch von 3 U-Pumpen (Br, 7, Br. 11, Br. 12) | Zielwert: Umsetzung der Maßnahme | St andorte: WW STE; W322 / I23, Soll -Termin: 2025 | ||
| Ene rgieressourc en-schonende Grundwas ser-entnahme durch passgenau ausgelegte und regelbare Pumpen | Austausch der U-Pumpe im Brunnen BSNL.11 gegen eine auf den Betriebspunkt angepasste Pumpe | Zielwert: spez. Verbrauch in kWh/100m³ | St andorte: WW SNL; W322, Soll -Termin: 2025 | |||
| Ene rgieressourc en-schonende Grundwas ser-entnahme durch passgenau ausgelegte und regelbare Pumpen | Ausstattung verschiedener Brunnen mit neuen, regelbaren und hocheffizienten U- Pumpen | Zielwert: 12 Pumpen | St andorte: WW SEM; W 341/I23, Soll -Termin: 2026 | |||
| En ergieressour censchonende Rückspülung der Filter durch passgenau ausgelegte Spülwa sserpumpen | Erneuerung Spülwasserpumpen | Zielwert: Umsetzung der Maßnahme | St andorte: WW SEM; W341/ I21/I23, Soll -Termin: 2026 | |||
| En ergieressour censchonende Abgabe durch passgenau ausgelegte und deutlich kleiner di mensionierte Reinw asserpumpe | Erneuerung der RWP 1. Pumpe geliefert und Einbau inklusive Rohrführung als nächster Schritt. | Zielwert: Umsetzung der Maßnahme | St andorte: WW SEM; W41/I23, Soll -Termin: 2025 | |||
| En ergieressour censchonende Rückspülung der Filter durch passgenau ausgelegte Spülwa sserpumpen | Erneuerung Spülwasserpumpen | Zielwert: Umsetzung der Maßnahme | St andorte: WW SEM; W41/I23, Soll -Termin: 2025 | |||
| Einführung eines Energiedat enreportings zur stan dardisierten u. aut omatisierten Erfassung und -auswertung der Energie verbräuche | Stammdaten sammeln und abgleichen; Dat enschnittstellen abstimmen Datenauswertung testen 2020: Testphase 2021: Abschluss des Projektes |
Zielwert: Reporting ist implementiert, Probephase begonnen | St andorte: alle, v.a. Werke u. Betrieb stechnik Q 2 in Ab stimmung mit FachOEs, HE, Soll -Termin: 2025 | |||
| Potenziale zur Verringerung Energi everbrauch | U nternehmensweite Abfrage in den operativen Bereichen, wie das gesetzlich vorgeschriebene 2 %-Minderungsziel umgesetzt werden kann | Zielwert: Entwicklung einer Maßnahmenliste | St andorte: Alle großen S tandorte und Verb raucher; Q2, Soll -Termin: 2025 | |||
| 2 . 4 | En ergieressour censchonende Abgabe durch passgenau ausgelegte und deutlich kleiner di mensionierte Reinw asserpumpe | Erneuerung der RWP 1. Pumpe geliefert und Einbau inklusive Rohrführung als nächster Schritt. | Zielwert: Umsetzung der Maßnahme | St andorte: WW SEM; W341/ I21/I23, Soll -Termin: 2026 | ||
| Steigerung des Anteils der ei generzeugten Energie | Planung und Stallation von Photovoltaik | Zielwert: Steigerung der E igenproduktion um 20% gegenüber 2019 durch diverse Maßnahmen | St andorte: WW CUR; W 23/Q2, Soll -Termin: 2026 | |||
| 2 . 4 |
|
Entwurfsplanung Wärmeversorgung | Zielwert: Zielwert: mindestens 50% Einsparung fossiler Energie (Erdgas) | St andorte: PwH; W51, Soll -Termin: 2025 | ||
| Senkung der CO2-Emission aus dem Wärm everbrauch | Sanierung des Bürogebäudes | Zielwert: bauliche Umsetzung | St andorte: WW CUR; W31, Soll -Termin: 2025 | |||
| Energetische Sanierung bzw. Optimierung der Bet riebsgebäude mit Blick auf Dämmung und Heizung | Erstellung einer Konzeptstudie für mögliche energetische Sa nierungmaßnahmen | Zielwert: Abschluss der Konzeptstudie | St andorte: Ww SNL; W323, Soll -Termin: 2025 | |||
| ' Energetische Sanierung bzw. Optimierung der Bet riebsgebäude mit Blick auf Dämmung und Heizung | Durchführung einer umfangreichen Planung zur Feststellung der erforderlichen Maßnahmen | Zielwert: Umsetzung der Maßnahme | St andorte: Ww BAU ; W321 / I25, Soll -Termin: 2025 | |||
| Dämmung der Ge bäudehülle | Dämmung Geschossdecke und Dach | Zielwert: bauliche Umsetzung | St andorte: WW GSE; W33, Soll -Termin: 2025 | |||
| Senkung der CO2-Emission aus dem Wärm everbrauch | Ersatz Ölheizung Großensee | Zielwert: Ersatz durch Wärmepumpe | St andorte: WW GSE; W33, Soll -Termin: 2026 | |||
| Deca rbonisierung der Wär meversorgung des Standorts Roth enburgsort | Anbindung an die Fer nwärmeversorgung | Zielwert: 'vermiedene Tonnen CO2 | St andorte: R'Ort; 'T bauliche Um setzung; Q vert ragliche Um setzung, Soll -Termin: 2025 | |||
|
Energetische Ertüchtigung der Wer ks-Wohneinheiten | Zielwert: 60% der Werks -Wohneinheiten sind energetisch saniert | St andorte: Werksw ohnungen und -häuser HWW und HSE; T21, Soll -Termin: 2026 | |||
|
Austausch der alten Gasdrucklampen durch LED-Beleuchtung auf dem Gelände, Gesamtzahl ca. 150 Stück, Reduzierung der Leistung von 80W auf 35W pro Lampe | Zielwert: 'Senkung des Energiebedarfs durch Einsatz von LED | St andorte: Ve rwaltung R'Ort; T23, Soll -Termin: 2025 | |||
| Deca rbonisierung Unternehmens -standorte | Anschluss des Standortes Ausschläger Allee an die Fer nwärmeversorgung | Zielwert: Umsetzung bis 2027; Schaffung der vertraglichen Grundlagen bis 2025 (An schlussvertrag mit Anbieter) | St andorte: Aus schläger Allee; Q2, Soll -Termin: 2027 | |||
| Deca rbonisierung der Wär meversorgung des Standorts Roth enburgsort | Anbindung an die Fer nwärmeversorgung | Zielwert: vermiedene Tonnen CO2 | St andorte: R'Ort; T bauliche Um setzung; Q vert ragliche Um setzung, Soll -Termin: 2025 | |||
| 2 . 5 |
|
Bau einer weiteren Dampfturbine in der Klärschlammve rbrennungsanlage zur E nergieerzeugung. | Zielwert: Teilziel 2024 ist die Fertigstellung des Rohbaus und zeitgerechte Umsetzung des übrigen B aufortschritts | St andorte: Klärwerk (Kö); W5, Soll -Termin: 2027 | ||
| 2 . 6 | Ab wärmenutzung aus Abwasser (Mach 2) |
Installation von Großwärmepumpen im Abwasserablauf der Dradenau zur Nutzung der Abwasserwärme. | Zielwert: Erstellen der Planung und Ausschreib ungsunterlagen bis Ende 2024; Baubeginn Mitte 2025; Bauende 2.Quartal 2026 | St andorte: Klärwerk D radenau; W5, Soll -Termin: 2026 | ||
| Verbesserung der e nergetischen Nutzung von Energie aus Schlämmen | Konkretisierung der Planung und Schaffen der Voraussetzungen für bauliche Maßnahmen bis 2027. Für Baubeginn in 2028 und Fertigstellung in 2032. | Zielwert: Entnahme von 250-300 GW/h Wärme pro Jahr. Bau fertigstellung bis Ende 2025. Betrieb ab 2026. | St andorte: Köhlbr andhöft; W52, Soll -Termin: 2032 | |||
| 2 . 7 | Steigerung des Anteils an ei generzeugter Energie im No rmalbetrieb; Ene rgieautarkie bei Blackout (Szenario 72 Stunden) | Ko nzepterstellung: Energieautarkie bei Blackout in der Zone Süd durch Kombination verschiedener Möglichkeiten (WEA, PV, Speicher, Kabeltrassen, etc. (zu prüfen)) | Zielwert: Zielwert: Erhöhung des Autarkiegrads des Wasserwerkes bei Blackout auf >90% für mindestens 72 Stunden | St andorte: WW SEM, WW NHE, WW BOS, WW NEU; W13, W34, Q2, Soll -Termin: 2025 | ||
| Steigerung des Anteils der ei generzeugten Energie | Konzept Errichtung einer WEA am Standort Großhansdorf | Zielwert: Zielwert: Prüfung, ob der Anteil eigenerzeugter Energie durch dein Einsatz einer WEA erhöht werden kann | St andorte: WW GHA; W13, W33, Soll -Termin: 2025 | |||
| Steigerung des Anteils an ei generzeugter Energie im No rmalbetrieb; Ene rgieautarkie bei Blackout (Szenario 72 Stunden) | Konzept und Planung zur Errichtung einer WEA und PV-F reiflächenanlage am Standort Curslack | Zielwert: Zielwert: Erhöhung des Autarkiegrads des Wasserwerkes bei Blackout auf >90% für mindestens 72 Stunden | St andorte: WW CUR; W13, W31, Q2, Soll -Termin: 2027 | |||
| Ausbau der r egenerativen Ener giequellen | Errichtung einer PV-Anlage Kö Nord | Zielwert: Errichtung einer PV-Anlage Kö Nord | St andorte: Klärwerk (Kö); W5, Soll -Termin: 2026 | |||
| Ausbau der r egenerativen Ener giequellen | Errichtung einer PV-Anlage Dradenau | Zielwert: Errichtung einer PV-Anlage Dradenau | St andorte: Klärwerk D radenau; W5, Soll -Termin: 2025 | |||
| Ausbau der r egenerativen Ene rgiequelle | Errichtung WEA auf Köhlbrandhöft und Einreichung des BImSchG-Antrages | Zielwert: Reduzierung des Energiebezugs von En ergieversorgun gsunternehmen. | St andorte: Klärwerk (Kö); W5, Soll -Termin: 2025 | |||
| Erhöhung der Ener gieerzeugung aus EE am Standort | Aufstellung einer PV-Anlage auf dem Dach des Bürogebäudes | Zielwert: v oraussichtlich installierte Leistung 26,4 kWp, Angabe kWh/a folgt in den nächsten Monaten | St andorte: WW CUR; W31, Soll -Termin: 2025 | |||
| Errichtung einer PV-Anlage auf dem We rksgelände | 'Errichtung einer PV-Anlage | Zielwert: Ene rgieeurzeugung | St andorte: Ww BAU ; W321, Soll -Termin: 2027 | |||
| PV Anlage auf Betri ebsgebäude | Erzeugung regenerativen Stroms aus PV Anlage zur direkten Verwendung im Betrieb | Zielwert: Erzeugung von ca. 73.000 kWh/a | St andorte: WW GSE; W33, Soll -Termin: 2026 | |||
| Steigerung des Anteils der ei generzeugten Energie | Erzeugung regenerativen Stroms aus PV Anlage zur direkten Verwendung im Betrieb | Zielwert: Erzeugung von ca. 75.000 kWh/a | St andorte: WW LAN; W33, Soll -Termin: 2025 | |||
| Steigerung des Anteils an ei generzeugter Energie im No rmalbetrieb; Ene rgieautarkie bei Blackout (Szenario 72 Stunden) | Ko nzepterstellung: Energieautarkie bei Blackout in der Zone Süd durch Kombination verschiedener Möglichkeiten (WEA, PV, Speicher, Kabeltrassen, etc. (zu prüfen)) | Zielwert: Zielwert: Erhöhung des Autarkiegrads des Wasserwerkes bei Blackout auf >90% für mindestens 72 Stunden | St andorte: WW SEM, WW NHE, WW BOS, WW NEU; W13, W34, Q2, Soll -Termin: 2025 | |||
| Steigerung des Anteils der ei generzeugten Energie | Konzept Errichtung einer WEA am Standort Großhansdorf | Zielwert: Zielwert: Prüfung, ob der Anteil eigenerzeugter Energie durch dein Einsatz einer WEA erhöht werden kann | St andorte: WW GHA; W13, W33, Soll -Termin: 2025 | |||
| Steigerung des Anteils an ei generzeugter Energie im No rmalbetrieb; Ene rgieautarkie bei Blackout (Szenario 72 Stunden) | Konzept und Planung zur Errichtung einer WEA und PV-F reiflächenanlage am Standort Curslack | Zielwert: Zielwert: Erhöhung des Autarkiegrads des Wasserwerkes bei Blackout auf >90% für mindestens 72 Stunden | St andorte: WW CUR; W13, W31, Q2, Soll -Termin: 2027 | |||
| Ausbau der r egenerativen Ener giequellen | Errichtung einer PV-Anlage Kö Nord | Zielwert: Errichtung einer PV-Anlage Kö Nord | St andorte: Klärwerk (Kö); W5, Soll -Termin: 2026 | |||
| 2 . 9 | Verbesserung der Fahrzeug Ladeinf rastruktur | Zusätzliche Ladesäulen für LKW in der neuen Logistik- und Fahrzeughalle | Zielwert: zusätzliche Ladesäulen auf dem Klärwerk | St andorte: Köhlbr andhöft; W51, Soll -Termin: 2027 | ||
| Flotte weiter elek trifizieren, da Ladesäulen vorhanden oder im Aufbau | abgängige Autos durch E-Fahrzeuge ersetzen | Zielwert: vollständig elektrifiziert bis 2030 | St andorte: WW Mi tte/Ost; W31, Soll -Termin: 2030 | |||
| 'Flotte weiter elekt rifizieren | abgängige Autos durch E-Fahrzeuge ersetzen | Zielwert: Umsetzung der Maßnahme | St andorte: Ww BAU, Ww SNL, WW STE; T / I21, Soll -Termin: 2030 | |||
| Förderung betriebliche Fahrr admobilität: "Di enst-Fahrrad statt Di enst-PKW" | Bike-Pool Rothenburgsort aufwerten und bewerben; Inspektion und Wartung der HW- Dienst-Pedelecs; Information in Wasserwelt und MS Teams; Vor-Ort-Termine auf HW-Standorten; Hinweis StadtRAD-Nutzung für Dienstfahrten; Fahrr ad-Streckentipps für typische Dienstwege; Azubi-Aktion; Diensträder im SAP; Einführung Lastenräder | Zielwert: 5 HW-Standorte besuchen; Steigerung Bik e-Pool-Nutzung (mehr E ntleihvorgänge als 2024) | St andorte: diverse; D, Soll -Termin: 2026 | |||
| 'CO2 -Reduktion | Bis 2030 Steigerung des Anteils elektrisch betriebener Pkw im
Fuhrpark auf 75%. Dazu bis 2026 Beauftragung der Bauleistungen über einen Rahmenvertrag, zum Ausbau der L adeinfrastruktur für Dienstfahrzeuge und Privatfahrzeuge der Mitarbeiter an allen HW-Standorten. Ausbau der L adeinfrastruktur an den Standorten WW Gruppe Ost und Süd. Aufabau der DC-Lader am den Standorten LED, STR, KBH. |
Zielwert: Dazu bis 2026 Beauftragung der Bauleistungen über einen Rahmenvertrag, zum Ausbau der Lad einfrastruktur für D ienstfahrzeuge und P rivatfahrzeuge der Mitarbeiter an allen HW-Standorten. Ausbau der Lad einfrastruktur an den Standorten WW Gruppe Ost und Süd. Aufabau der DC-Lader am den Standorten LED, STR, KBH. | St andorte: Alle St andorte; T2, Soll -Termin: 2026 | |||
| Flotte weiter elek trifizieren, da Ladesäulen vorhanden | abgängige Autos durch E-Fahrzeuge ersetzen | Zielwert: vollständig elektrifiziert bis 2030 | St andorte: WW NORD; W33, Soll -Termin: 2030 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Reduzierung der Lachgasemissionen in der Belebungsanlage Köhlbrandhöft | Durchführung der N2O-Onlinemessung in der Belebungsanlage Köhlbrandhöft und Ableitung einer Fahrweise | Zielwert: Feststellung der N2O-Emissionen; Durchführung einer Messkonzeption und Entwicklung einer Fahrweise | Standorte: Klärwerk (Kö); W51, Soll-Termin: 2025 | |
| 3.3 | Gewinnung von CO2 aus Faulgas als Einsatzstoff für industrielle Anwendungen oder für die Nahrungsmittelindustrie | Bau einer Verflüssigungsanlage für biogenes CO2 aus der Gasaufbereitung | Zielwert: Umsetzung der Maßnahme; Planung und Bau einer Verflüssigungsanlage einschließlich Lagerung für den CO2-Abgasstrom aus der Gasaufbereitungsanlage GALA II. Dieses biogene Kohlendioxid wird derzeit in die Atmosphäre entlassen und soll zukünftig stofflich genutzt werden. | Standorte: Klärwerk (Kö); W52, Soll-Termin: 2026 | |
| 3.4 | Vermehrte Erzeugung von regenerativer Energie durch Erniedrigung des Abdampfdruckes der Dampfturbine | Überprüfung der Umrüstung des luftgekühlten Kondensators der VERA zu einer Luft- oder Wasserkühlung zur Verbesserung der Energieausbeute | Zielwert: Prüfung, ob und wie die Kühlung durch Installation von Wärmetauschern in der Belebungsanlage KöSüd möglich und wirtschaftlich ist. | Standorte: Klärwerk (Kö); W53, Soll-Termin: 2025 | |
| 3.6 | Klimaschutzplan - Baumaßnahmen | Ansätze zur THG-Reduktion bei den Baumaßnahmen beschreiben und bewerten (Zusätzlicher Aufwand) | Zielwert: Ansätze und Kosten an Q (Klimaschutzplan) und AM (Investitionsplanung) geliefert. | Standorte: R'Ort; I02, Soll-Termin: 2025 | |
| Klimaschutzplan - Rahmenvertrag zur THG-Bilanzierung beauftragen. | Ausschreibung erstellen und veröffentlichen. | Zielwert: Berater Beauftragt | Standorte: R'Ort; I02, Soll-Termin: 2025 | ||
| Klimaschutzplan - EPDs in den Ausschreibungen einfordern | Ausschreibungsunterlagen aktualisieren: EPDs sind vorzulegen. Im Ersten Schritt einfordern. | Zielwert: Ausschreibungsunterlagen sind aktualisiert und an die Bieter kommuniziert. | Standorte: R'Ort; I02/B42, Soll-Termin: 2025 | ||
| Senkung der Treibhausgas-emissionen des Unternehmens | Verabschiedung des Klimaschutzplans | Zielwert: Teilziel 2022: '1.) Verbesserung der Datengrundlage für Scope 1 und 2 Teilziel 2023: 2.) Verbesserung der Datengrundlage für Scope 3 Teilziel 2024: 3.) Verbesserung der Datengrundlage für Scope 1 - 3 Teilziel 2025: 4.) Klimaschutzplan mit THG-Reduktionszielen verabschiedet |
Standorte: HW; Q13, Soll-Termin: 2025 | ||
| 3.9 | Reduzierung des Verbrauchs fossiler Kraftstoffe | Beschaffung eines elektrobetriebenen Lastkraftwagens für den Abfalltransport auf Köhlbrandhöft | Zielwert: Steigerung der Eigenproduktion am Standort GHA um 20% gegenüber 2019 und Errichtung von mindestens 1 WEA | Standorte: Klärwerk (Kö); W53, Soll-Termin: 2025 | |
| Substitution der verwendeten Flockungsmittel zur Überschuss-schlammeindickung | Substitution der verwendeten Flockungsmittel | Zielwert: Verringerung des CO2-Fußabdrucks | Standorte: Köhlbrandhöft; W52, Soll-Termin: 2025 | ||
| Förderung Pendler-Fahrradmobilität: "Fahrrad statt Auto" | Monatliche Radfahrertreffen; Reparaturen/Ersatzteile für Self-Service; Mobiler Fahrradladen in Ro'ort; Unterstützung/Förderung HW-Dienstrad-Leasing; Duschen/Umkleiden/Spinde für Radfahrende; diverse Mitmach-Aktionen; Fahrradlotsen für Neu-Radler; Info-Flyer; Lademöglichkeit Privat-Pedelec-Akku | Zielwert: 10 x Online Fahrrad-Info-Treffen; 3 x Mobiler Fahrradladen R'ort; 100 Teilnehmer bei HW- STADTRADELN | Standorte: diverse; HW, Soll-Termin: 2026 | ||
| Durch die Nutzung des angebotenen Dienstrad-Leasings nutzen mehr Mitarbeitende das Fahrrad für An- und Abreise zum Arbeitsort. Zudem werden auch kurze dienstliche Strecken auf dem Fahrrad erledigt. Auf diese Weise werden Emissionen eingespart. | Das Leasing von Diensträdern wird finanziell unterstützt. Das Angebot wird in der Belegschaft beworben. | Zielwert: Methodik und Vorgehen an Piloten getestet | Standorte: HW; P3, Soll-Termin: 2025 | ||
| 3.11 | Verbesserung der Rechengut-bewirtschaftung durch Regenschutz. | Bau einer Containerhalle | Zielwert: Verbesserung der Verbrennungs-eigenschaften des Rechengutes. Verringerung der Emission | Standorte: Köhlbrandhöft; W51, Soll-Termin: 2027 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Umweltverträgliche Beschaffung | Berücksichtigung der Aspekte aus dem § 3b des Hamburgischen Vergabegesetzes - Umweltverträgliche Beschaffung von Liefer- und Dienstleistungen in allen Ausschreibungsfällen | Zielwert: 0 --> Abweichung von § 3b des Hamburgischen Vergabegesetzes - Umweltverträgliche Beschaffung von Liefer- und Dienstleistungen |
Standorte: R'Ort; B4, Soll-Termin: 2025 | |
| Betriebs- und Verbrauchs-materialien reduzieren | Senkung des Papierverbrauchs durch zunehmende Digitalisierung, Erhöhung von digitalen Prozessen- Unterstützung der digitalen Signatur | Zielwert: - Ableitung von ersten
grundlegenden Empfehlungen: Welche Vorgaben des BNatSchG müssen bei
Biotopen beachtet werden? - Weitergabe von Informationen im Rahmen der Umweltbetriebs-prüfungen |
Standorte: R'Ort; P1 - P4, Soll-Termin: 2025 | ||
| 4.2 | Sicherer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | Prüfung der Betroffenheit der Anlagen auf den Wasserwerksstandorten durch die Anforderungen der AwSV, Ermittlung der Gefährdungsstufen und Umsetzung der Bedarfe | Zielwert: Reduzierung der Anzahl von Produkten mit Gefahrstoffkennzeichnung gegenüber 2019 um -10 % bis 2025 | Standorte: WW Mitte/Ost; W31, Soll-Termin: 2025 | |
| 4.4 | Etablierung werks-übergreifendes
Betriebsstoff-monitoring (Gefahrstoffe, wassergefährdende Stoffe, Schadstoffe) |
Standardisierte Betriebsbegehungen, Katastermonitoring und Unterstützung bei Inventurmaßnahmen |
Zielwert: Verbesserung der Datenverfügbarkeit in Bezug auf Ist- und Soll-Bestände | Standorte: alle Wasserwerke; W222, Soll-Termin: 2026 | |
| 4.5 | Verbesserung des Chemikalieneinsatzes in der Klärschlamm-verbrennung | Anpassung der Verfahren zur Verringerung des Chemikalieneinsatzes zur Schwermetallabscheidung | Zielwert: Verringerung des Chemikalieneinsatzes und Nachweis | Standorte: Köhlbrandhöft; W53, Soll-Termin: 2025 | |
| Durch die Digitalisierung von Prozessen wird der Papierverbrauch im Personalbereich gesenkt. | Der Prozess zur Beantragung von Elternzeit wird digitalisiert. | Zielwert: Der Prozess ist digitalisiert. Zielwert 1 | Standorte: HW; P1, Soll-Termin: 2025 | ||
| 4.7 | Durch die Digitalisierung von Prozessen wird der Papierverbrauch im Personalbereich gesenkt. | Der Prozess zur Auslagenerstattung wird digitalisiert. | Zielwert: Der Prozess ist digitalisiert. Zielwert 1 | Standorte: HW; P1, Soll-Termin: 2025 | |
| Durch die Digitalisierung von Prozessen wird der Papierverbrauch im Personalbereich gesenkt. | Der Prozess zur Beantragung von Teilzeit wird digitalisiert. | Zielwert: 100% der in 2024 mit der Unterstützung von HW implementierten RISA-Maßnahmen sind dokumentiert und veröffentlicht | Standorte: HW; P1, Soll-Termin: 2025 | ||
| Durch die Digitalisierung von Prozessen wird der Papierverbrauch im Personalbereich gesenkt. | Der Prozess zur Anzeige einer Schwangerschaft wird digitalisiert. | Zielwert: Anteil der Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben verringern | Standorte: HW; P2, Soll-Termin: 2025 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammanlagen | Umsetzung der Optimierungsprojekte | Das Ziel ist in 2024 den Regelbetrieb der TPHH zu erreichen. | Klärwerk (Kö); W5, Soll-Termin: 2025 | |
| 5.4 | Abfallbilanz-erstellung optimieren | Einführung einer Datenbank zur unternehmensweiten Erfassung von Abfallmengen und -arten. | Zielwert: Ausschreibung der Software | Standorte: R'Ort; I02/D35, Soll-Termin: 2025 | |
| 5.6 | Koordination der Entsorgungsprozesse von mit Radionukliden belastetem Filterkies im Rahmen der W256 | Abstimmung mit den jeweils Zuständigen Behörden (formale Entlassung aus dem Strahlenschutzrecht) | Zielwert: klar geregelte Entsorgungswege im Raum Hamburg/SH | Standorte: alle Wasserwerke; W222, Soll-Termin: 2025 | |
| 5.7 | Koordination ordnungsgemäßer
Abfalltrennung, sowie Abfallmengen-minderung an den
Wasserwerks-standorten Steuerung der Nachweisführung gemäß NachwV |
Koordination des Abfallmanagements in den Wasserwerken | Zielwert: Optimierung der Prozesse im Sinne der Kreislaufwirtschaft | Standorte: alle Wasserwerke; W222, Soll-Termin: 2026 | |
| Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfalltrennung auf den Wasserwerks-standorten | Benennung und Schulung von Abfallbeauftragten am Standort | Zielwert: Zielwert: Benennung von Abfallbeauftragten am Standort für jedes Wasserwerk | Standorte: W3; W222, Soll-Termin: 2025 | ||
| Reduzierung des Abfallaufkommens und Verbesserung der Wertstofftrennung | Entwicklung eines Konzeptes zur Abfallvermeidung | Zielwert: Reduzierung der Restmüllmenge bis 2025 um 5 % gegenüber 2021 | Standorte: Netzbetriebe; N, Soll-Termin: 2025 | ||
| 5.8 | Koordination ordnungsgemäßer Abfalltrennung, sowie Abfallmengen-minderung an den Wasserwerks-standorten | ||||
| 5.13 | Abfallvermeidung: Wiedereinbau Sand fördern | Schulung der Meister des Bau- und Fremdfirmeneinsatzes und der eigenen Kolonnen zur EBV und der Gründe Sand vermehrt wieder einzubauen | Zielwert: Schulung wurde durchgeführt | Standorte: Alle Bezirke; N101, Soll-Termin: 2026 | |
| Abfallvermeidung: Vermehrter Einsatz des Keyhole-Verfahrens inkl. Nutzung von Long-handled Tools in jedem Bezirk zur Senkung des Abfallaufkommens (Straßenaufbruch und Boden) | Förderung des Keyhole-Verfahrens inkl. Nutzung von Long-handled Tools mit Zielwert. Optimierung des Prozesses zur systematischen Übermittlung der Aufträge aus West und Nord an Mitte. Optimierung der Abläufe zur besseren Auslastung des Keyhole-Bohrers. Einsatz des neuen Saugbaggers. | Zielwert: Anzahl an Keyhole-Verfahren inkl. Nutzung von Long-handled Tools für mind. 100 Baustellen in allen Bezirken | Standorte: Alle Bezirke; N2, Soll-Termin: 2026 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit in RISA zur Bewusstseinsbildung im Umgang mit dem Naturnahen Wasserhaushalt, Starkregenvorsorge, Abkopplung, Regenwasser-behandlung | Erweiterung der RISA Website mit Informationen zur Umsetzungsmöglichkeiten der Schwammstadt in Hamburg, (z.B. Maßnahmenkatalog zur Regenwasserbewirtschaftung) und Ausstellung zu RISA Projekten (Wanderausstellung) Teilnahme und Durchführung von Veranstaltungen | Zielwert: Maßnahmenkatalog auf Website, mindestens eine Ausstellung und Veranstaltung. | Standorte: FHH, Website; E1, Soll-Termin: 2026 | |
| Basisinformationen über Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Gewässer- und Ressourcenschutz und gewässerschonendes Konsumverhalten (Kommunikations-maßnahmen U1, Berichterstattung) | Monatlich eine Kommunikationsmaßnahme zum Thema Umwelt // Nachhaltigkeit, das HAMBURG WASSER als umweltfreundliches Unternehmen positioniert und der Öffentlichkeit umweltschonendes Verhalten näherbringt. Die konkreten Maßnahmen können auch auf gewässerschonendes Verhalten hinweisen | Zielwert: 12 | Standorte: R'Ort; U1, Soll-Termin: 2025 | ||
| 6.2 | Fachlicher Austausch zu Erfahrungen über umgesetzte Maßnahmen um Informationen effizient teilen und die Zusammenarbeit sowie den Fortschritt im Bereich der Entwässerung, RISA, usw. fördern und mitgestalten | Austausch auf diversen Fachveranstaltungen, Wissensweitergabe durch Fachvorträge | Zielwert: 3 Vorträge auf Fachveranstaltungen | Standorte: Deutschland; E1, Soll-Termin: 2025 | |
| 6.4 | Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit relevante Behörden und Stakeholdern, Förderung von Austausch und gemeinsame Lösungen für die Gemeinschaftsaufgabe RISA sowie behörden-übergreifende Maßnahmen-koordinierung. | Erarbeitung und Vorstellung von Konzepten und ggf. Durchführung von Austauschformaten, Workshops | Zielwert: gemeinsame Durchführung eines übergreifenden Austauschformats zur Vernetzung der involvierten Stakholder. | Standorte: FHH; E1, Soll-Termin: 2025 | |
| Zielgerichtete Sensibilisierung politischer Stakeholder für wasserpolitische Themen | Versand von Positionspapieren im Nachgang zu Bürgerschafts- und Bundestagswahl | Zielwert: 2 | Standorte: R'Ort; U1, Soll-Termin: 2025 | ||
| 6.5 | Durch den Einsatz von internen Kommunikations-kanälen werden die Mitarbeitenden über das Umweltprogramm und laufende Maßnahmen informiert und so für das Thema sensibilisiert. | Mindestens einmal pro Quartal wird ein Artikel rund um das Thema "Umweltprogramm" (z.B. im Intranet oder anderen Medien) veröffentlicht. | Zielwert: Veröffentlichte Beiträge: Zielwert 4 | Standorte: HW; P4, Soll-Termin: 2025 | |
| Prozessstabilität Datenerhebung | Als interner Businesspartner mit fachlicher Verantwortung für das dezentrale Controlling aller Bereich entwickelt, erhebt und analysiert B Kennzahlen im ganzen Haus. | Zielwert: 6 -->Dezentrale Controller in allen Bereichen |
Standorte: R'Ort; B2, Soll-Termin: 2025 | ||
| Maßnahmen um Informationen, Wissen zum nachhaltigen Regenwasser-management teilen und Unterstützung für KollegInnen anbieten. | Austausch mit den Bereichen zum Angebot für interne Vorträge, Austauschrunden, Wissenstransfer. Bei Bedarf ggf. Umsetzung. | Zielwert: Alle HW- Bereiche ansprechen. | Standorte: HW; E1, Soll-Termin: 2026 |
| Nr. | Umweltziel | Maßnahmen | Zielwert | Standorte, Soll-Termin | |
|---|---|---|---|---|---|
| n.w. | Senkung des Wassereigen-verbrauchs | Prüfung zum Spülwasserrecycling auf Wasserwerksstandorten | Standortspezifische Konzepte für den Umgang mit Spülwasser | u.a. WW BAU, WW CUR; W1, Soll-Termin: 2026 |
| Abkürzung | Erläuterung |
|---|---|
| ALKIS | Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem |
| AMB | Arbeitssicherheitsmanagementbeauftragte:r |
| ASiKo | Arbeitssicherheitsmanagement-Koordinator:in |
| AwSV | Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen |
| AZV | Abwasser-Zweckverband |
| BHKW | Blockheizkraftwerk |
| BImSchV | Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes |
| BNatSchG | Bundesnaturschutzgesetz |
| BUE / BUKEA | Behörde für Umwelt und Energie, 2020 umbenannt in Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft |
| BVT | Beste Verfügbare Techniken |
| CSB | Chemischer Sauerstoffbedarf |
| CTT | Container Terminal Tollerort |
| DIN | Deutsche Industrienorm |
| DüV | Düngeverordnung |
| EMAS | Eco-Management and Audit Scheme, europäisches Umweltmanagementsystem |
| EN | Europäische Norm |
| EPD | Environmental Product Declaration (Umwelt-Produktdeklaration), beschreibt die Abbildung von umweltrelevanten Eigenschaften eines Produktes auf möglichst objektiver Datenbasis |
| EU | Europäische Union |
| EW | Einwohnerwerte |
| FASi | Fachkraft für Arbeitssicherheit |
| FHH | Freie und Hansestadt Hamburg |
| FKW | Fluorkohlenwasserstoffe. Englisch heißen Fluorkohlenwasserstoffe Hydrofluorocarbons, weshalb sich häufig auch im Deutschen die Abkürzung HFC für sie findet. |
| GALA | Gasaufbereitungs- und -einspeisungsstation |
| GbV | Gefahrgutbeauftragtenverordnung |
| GewAbfV | Gewerbeabfallverordnung |
| GHG Protocol | Greenhouse Gas Protocol |
| GIS | Geoinformationssystem |
| GMH | Gebäudemanagement Hamburg |
| GwSB | Gewässerschutzbeauftragte:r |
| HCGK | Hamburger Corporate Governance Kodex |
| HFKW | Teilhalogenierte Kohlenwasserstoffe |
| HH | Hamburg |
| HHLA | Hamburger Hafen und Logistik AG |
| HPHOR | Hamburger Phosphorrecyclinggesellschaft mbH |
| HPW | Hauptpumpwerk |
| HSE | Hamburger Stadtentwässerung AöR |
| HW | HAMBURG WASSER |
| HWW | Hamburger Wasserwerke GmbH |
| IMS | Integriertes Management System |
| IPCC | Weltklimarat (englisch: Intergovernmental Panel on Climate Change) |
| ISO | Internationale Organisation für Normung (englisch: International Organization for Standardization) |
| KrWG | Kreislaufwirtschaftsgesetz |
| KW | Klärwerk |
| OTR | Organischer Trockenrückstand |
| PAC | Polyaluminiumchlorid |
| QMB | Qualitätsmanagementbeauftragte:r |
| QU-Ko | Qualitäts- und Umweltmanagementsystem-Koordinator:in |
| RISA | RegenInfraStrukturAnpassung |
| R-Verfahren | Verwertungsverfahren nach KrWG |
| SBH | Schulbau Hamburg |
| SiB | Sicherheitsbeauftragte:r |
| SumC | Gesamtkohlenstoff |
| UMB | Umweltmanagementbeauftragte:r |
| VdM | Verzeichnis der Maßnahmen |
| VdR | Verzeichnis der Rechtsvorschriften |
| VERA | Verwertungsanlage für Rückstände aus der Abwasserbehandlung, VERA Klärschlammverbrennung GmbH |
| WEA | Windenergieanlage |
| WR | Wasserrecht |
| WRE | wasserrechtliche Erlaubnis |
| WSG | Wasserschutzgebiet |
| WW | Wasserwerk |
| ZVB | Zusätzliche Vertragsbedingungen |
| autark | Von der Umgebung unabhängig, sich selbst versorgend. |
| Betriebsprüfer:in (Auditor:in) | Prüft im Namen der Unternehmensleitung als interne oder externe Person, ob die selbst gesetzten Ziele im Umweltschutz erreicht wurden und sich das Umweltmanagementsystem positiv weiterentwickelt hat. Im Gegensatz zum/zur Umweltgutachter:in stellt die betriebsprüfende Person die „Innenrevision” im Umweltschutz dar. |
| DIN EN ISO 14001:2015 | Das Umweltmanagement ist der Teilbereich des Managements eines Unternehmens, der sich mit Umweltschutzbelangen der Organisation beschäftigt. Es dient der Sicherung einer nachhaltigen Umweltverträglichkeit der Prozesse und Produkte und soll auch auf umweltschonende Verhaltensweisen der Mitarbeitenden, Lieferunternehmen oder auch Kundschaft hinwirken. Ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14000 ff - Normreihe kann von einem zugelassenen Auditor:in geprüft und anschließend zertifiziert werden (analog ISO 9000 ff - Qualitätsmanagement). |
| DIN EN ISO/IEC 17025:2018 | International gültige Norm, die die allgemeinen Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem und die Arbeitsweise von Prüf- und Kalibrierlaboratorien beschreibt. |
| Düker | Abwasserleitung zur Unterquerung von Bauwerken und Gewässern. |
| Einwohnerwert | Der Einwohnerwert (EW) ist der in der Wasserwirtschaft gebräuchliche Vergleichswert für die in Abwässern enthaltenen Schmutzfrachten. Mit Hilfe des Einwohnerwertes lässt sich die Belastung einer Kläranlage abschätzen. Er ist gleich der Summe aus Einwohnerzahl und Einwohnergleichwert. |
| Ein wohnergleichwert | Der Einwohnergleichwert ist die Belastung aus industriellen Abwässern umgerechnet in Einwohnerwerte. |
| EMA S-III-Verordnung | Eco Management and Audit Scheme/ EG-Öko-Audit-Verordnung; EG-Verordnung „über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung”. In dem freiwilligen System wird die interne Umweltüberprüfung durch externe, staatlich zugelassene, unabhängige Umweltgutachter:innen kontrolliert. Die geprüften Unternehmensstandorte werden in einem öffentlichen Verzeichnis registriert. |
| Emission | Unter dem Begriff Emission wird die ausgehende Luftverunreinigung, deren Quellen natürlichen oder anthropogenen (vom Menschen ausgehenden) Ursprungs sein können, verstanden. |
| Entlastungsmenge | Wassermenge, die bei starkem Regen aus einem Entlastungsbauwerk (betrifft Mischwasserkanalisation) in ein Gewässer abgeleitet wird. |
| EURO-Normen | Bei den EURO-Normen handelt es sich um Abgasnormen bzw. Schadstoffklassen, die Emissionsgrenzwerte für Kraftfahrzeuge vorschreiben. |
| ISO 27001-Zertifikat | Über ein ISO 27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz wird zunächst nachgewiesen, dass IT-Grundschutz im betrachteten Informationsverbund erfolgreich umgesetzt worden ist. Darüber hinaus zeigt ein solches Zertifikat auch, dass in der jeweiligen Institution Informationssicherheit ein anerkannter Wert ist, ein funktionierendes Informationssicherheitsmanagement vorhanden ist und außerdem zu einem bestimmten Zeitpunkt ein definiertes Sicherheitsniveau erreicht wurde.64 |
| Flächenverbrauch | Kennzahl für die biologische Vielfalt, ausgedrückt in m² bebauter Fläche. |
| Fremdwasser | Grundwasser und Niederschlagswasser, welches durch Undichtigkeiten oder Fehlanschlüsse im privaten und öffentlichen Rohrleitungssystem in das Siel eindringt. Zu dem Fremdwasser zählt auch Niederschlagswasser, welches in Trenngebieten durch Fehlanschlüsse in das Schmutzwassersiel gelangt. |
| Gesamtphosphor | (Pges): Umfasst das ortho-Phosphat und die organischen Phosphorverbindungen im Abwasser. |
| Gesamtstickstoff | (Nges): Umfasst Ammonium, Nitrat, Nitrit und Zwischenverbindungen (als anorganische Stickstoffverbindungen) sowie organische Stickstoffverbindungen im Abwasser. |
| Gru ndwasserdargebot | Die sich durch den zur Versickerung kommenden Anteil der Niederschläge und durch Infiltration aus Gewässern stetig erneuernde Menge an Grundwasser in einem bestimmten Gebiet. |
| Gült igkeitserklärung | Zugelassene Umweltgutachtende prüfen anhand von Unterlagen, Interviews und Betriebsbegehungen, ob Umweltpolitik, -programm, -managementsystem, Umweltbetriebs- und Umweltprüfung mit den Vorgaben der EG-Verordnung EMAS übereinstimmen. Kommt die Person zur Überzeugung, dass dies der Fall ist und die Umwelterklärung den EMAS-Vorgaben entspricht, erklärt der/die Gutachter:in die Erklärung für gültig. |
| Immission | Eintrag von Schadstoffen, aber auch von Lärm, Licht, Strahlung oder Erschütterungen in ein Umweltmedium. |
| Kanalisation | Rohrleitungssystem, in dem Abwasser gesammelt und transportiert wird, in Hamburg: Siel. |
| M ischkanalisation | Schmutz- und Niederschlagwasser werden in ein- und demselben Siel abgeleitet. |
| Monitoring | Langfristige, regelmäßig wiederholte und zielgerichtete Erhebungen im Sinne einer Dauerbeobachtung mit Aussagen zu Zustand und Veränderungen von Natur und Landschaft. |
| Nebelung | Die Nebelung (Mischung aus Wasser und Glykol) wird im Abwasserbereich zur Überprüfung von Rohrleitungen und Kanälen eingesetzt, um Fehlanschlüsse zu identifizieren. Dabei wird künstlicher Nebel in das Abwassersystem eingeleitet und beobachtet, an welcher Stelle dieser austritt. |
| Qua litätsmanagement | Das Qualitätsmanagement (QM) ist ein Teilbereich des Managements mit dem Ziel der Optimierung von Arbeitsabläufen oder von Geschäftsprozessen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit mit Produkten und Dienstleistungen. |
| Regenerative Energie | Erneuerbare Energien aus nachhaltigen Quellen. |
| Reinwasser | Wasser nach der Wasseraufbereitung. |
| Rohwasser | Unbehandeltes Wasser vor der Wasseraufbereitung. |
| Rückhaltebecken | Speicherraum für Regenabflussspitzen in Misch- oder Trennkanalisation. |
| Sammler | Größeres Siel, das Abwasser von mehreren kleinen Entwässerungssielen übernimmt und eventuell über ein Transportsiel den Klärwerken zuleitet. |
| Schmutzfracht | Die Schmutzfracht (bzw. nur Fracht) ist eine Maßzahl für den Zu- oder Ablauf einer Kläranlage oder die in einem Gewässer enthaltene Schadstoffmenge pro Zeiteinheit. Sie ergibt sich aus der Multiplikation von Stoffkonzentration und Wassermenge. |
| Schmutzwasser | Kommunales und gewerblich-/industrielles Abwasser, welches zur Kläranlage abgeleitet wird. |
| SCOPE 1- 3 | Dt. „Geltungsbereich oder Kategorie”: Umfasst auf der Grundlage des Greenhouse Gas Protocol alle Emissionen, die zur Fertigstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung benötigt werden. Die Unterscheidung in unterschiedliche Kategorien ermöglicht die Trennung von Emissionen innerhalb des Unternehmens und zwischen Unternehmen. Scope 1 steht dabei für Emissionsquellen, die direkt innerhalb des Unternehmens liegen und von diesem kontrolliert werden. Scope 2 umfasst alle Emissionen aus eingekaufter Energie. Scope 3 beschreibt vor- und nachgelagerte Emissionen in der Wertschöpfungskette. |
| Sedimentation | Das Ablagern oder Absetzen von Teilchen unter dem Einfluss der Schwerkraft. |
| Siel | In Hamburg gebräuchlicher Begriff für Kanalisation. |
| Speichersiel | Siel, das aufgrund seines Volumens in der Lage ist, über den mehrfachen Trockenwetterabfluss hinausgehende Abwassermengen kurzfristig zwischenzuspeichern. Kombiniert die Funktion von Transportsiel und Mischwasserrückhaltebecken. |
| Spülwasser | Wasser, welches zum Säubern und als Transportmedium für Feststoffe dient, z.B. für die Filterrückspülung. |
| Spülwasserrecycling | Recycling von Spülwasser im Wasserwerk, welches erneut für die Trinkwasserproduktion zur Verfügung steht. |
| Spülwasserverbrauch | Spülwasser wird dem Spülwasserverbrauch zugerechnet, welches in den Vorfluter eingeleitet wird und nicht mehr für die Trinkwasserproduktion zur Verfügung steht. |
| Stammsiel | Siel mit Sammel- und Transportfunktion im Hamburger Mischsielgebiet älterer Bauart. |
| Transportsiel | Siel, welches Abwasser über längere Strecken transportiert, aber nicht sammelt (nur Zu- und Abfluss). |
| Trennkanalisation | Im Gegensatz zur Mischkanalisation werden hier Schmutzwasser und Niederschlagswasser in getrennten Sielen gesammelt und abgeleitet. |
| Trumme | Straßeneinlauf, auch als Gully bekannt. |
| Überlaufbauwerk | Bauwerk im Mischwassersiel oder an Mischwasserrückhaltebecken, welches ab einem gewissen Pegelstand im Siel Mischwasser in ein Gewässer überlaufen lässt, um Rückstau in die Hausanschlussleitungen zu verhindern. |
| Umweltaspekt | Bezeichnet einen Aspekt der Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens, der Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. Das Unternehmen entscheidet anhand von zuvor festgelegten Kriterien, welche Umweltaspekte wesentliche Auswirkungen haben und daher die Grundlage für die Festlegung seiner Umweltziele bilden. Diese Kriterien sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Man unterscheidet direkte und indirekte Umweltaspekte. Direkte Umweltaspekte betreffen die Tätigkeiten des Unternehmens, deren Ablauf es kontrolliert. Indirekte Umweltaspekte betreffen die Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens, die es unter Umständen nicht in vollem Umfang kontrollieren kann, wie z. B. das Umweltverhalten von Lieferunternehmen. |
| Umweltauswirkung | Jede positive oder negative Veränderung der Umwelt, die ganz oder teilweise aufgrund der Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens eintritt. |
| Umweltkennzahlen | Daten, die für die Umweltsituation eines Unternehmens von Bedeutung sind (Abfallmengen, Emissionen, Wasserverbrauch usw.). Absolute Umweltkennzahlen werden auf eine Zeiteinheit bezogen (Menge pro Jahr), relative Kennzahlen werden mit einer aussagekräftigen Bezugsgröße ins Verhältnis gesetzt (z. B. Energieeinsatz der Trinkwasserbereitstellung kWh/m³). |
| Umweltleistung | Bezeichnet die Management-Ergebnisse des Unternehmens hinsichtlich der Umweltaspekte der Unternehmenstätigkeit. |
| Umweltmanagement-system | Das Umweltmanagementsystem ist Teil des Integrierten Managementsystems und betrifft die Organisationsstruktur, Planungstätigkeiten, Verantwortlichkeiten, Verhaltensweisen, Vorgehensweisen, Verfahren und Mittel für die Festlegung, Durchführung, Verwirklichung, Überprüfung und Fortführung der Umweltpolitik. Näheres ist in Kapitel 2 beschrieben. |
| Umweltziele | Auf der Grundlage des Unternehmensleitbildes setzt sich das Unternehmen in Bezug auf die Umwelt selbst Zielvorgaben, die nach Möglichkeit mit Mengen- und Zeitangaben verknüpft sind. Die Umweltziele und die nachgeordneten Einzelmaßnahmen zur Erreichung der Ziele werden im Umweltprogramm, vgl. Kapitel 4, abgebildet. |
| Wasserrechtliche Bewilligung | Gewährt das Recht, ein Gewässer in einer nach Art und Maß bestimmten Weise zu benutzen; sie kann befristet werden. Höherwertig als Wasserrechtliche Erlaubnis. |
| Wasserrechtliche Erlaubnis | Gewährt die widerrufliche Befugnis, ein Gewässer zu einem bestimmten Zweck in einer nach Art und Maß bestimmten Weise zu benutzen; sie kann befristet werden. |
| VERA | Seit Ende 1997 wird der teilgetrocknete Klärschlamm zusammen mit dem Rechen- und Siebgut aus der mechanischen Abwasserbehandlung in der Verwertungsanlage für Rückstände aus der Abwasserbehandlung, der VERA, thermisch verwertet. Seit 2018 wird die Umweltleistung der VERA über die Umwelterklärung von HAMBURG WASSER miterfasst. |
Wasserwerksgruppe Mitte / Ost
Wasserwerksgruppe Nord
Wasserwerksgruppe Süd
Wasserwerksgruppe West
In diesem Anhang sind relevante Kennzahlen für die einzelnen Standorte zusammengefasst. Abbildung 0‑1 zeigt eine Übersichtskarte aller EMAS-Standorte von HAMBURG WASSER. An einigen Standorten befinden sich Dienstwohnungen. Diese sind nicht Bestandteil des Umweltmanagement-systems und der vorliegenden Umwelterklärung. Die angegebene bebaute Fläche sowie der Versiegelungsgrad der Standorte beruhen auf Liegenschaftsdaten (ALKIS).
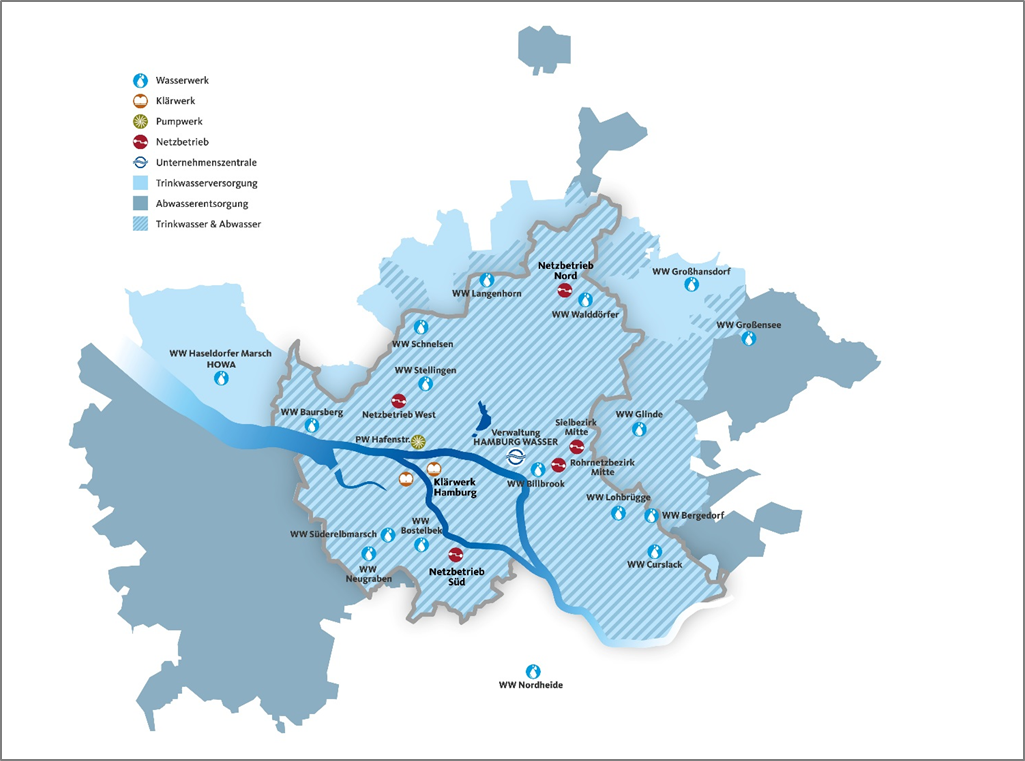
| Verwaltung Billhorner Deich und Wasserlabor | Kundencenter | ||
|---|---|---|---|
| Billhorner Deich 2 20539 Hamburg |
Ballindamm 1 20095 Hamburg |
||
| Mitarbeitende | Anzahl | 1096 | 8 |
| Fläche des Standortes | m² | 132.0731 | keine Angaben (Mietobjekt) |
| Bebaute Fläche | m² | 38.3281 | keine Angaben (Mietobjekt) |
| Versiegelungsgrad | % | 29 | keine Angaben (Mietobjekt) |
| Elektrische Energie | GWh | 2,43 | 0,04 |
| Andere Energieträger (Wärme) | GWh | 2,65 | - |
| Energieverbrauch Fuhrpark | GWh | 0,66 | - |
| nicht gefährlich | t | 711,2 | 0,1 |
| gefährlich | t | 5,7 | 0,1 |
| Material- und Abfallwirtschaft | Wassermessung | ||
|---|---|---|---|
| Ausschläger Allee 171 20539 Hamburg |
Ausschläger Allee 173 20539 Hamburg |
||
| Mitarbeitende | Anzahl | 17 | 83 |
| Fläche des Standortes | m² | 36.5771 | |
| Bebaute Fläche | m² | 30.4231 | |
| Versiegelungsgrad | % | 83 | |
| Energie | |||
| Elektrische Energie | GWh | 0,18 | 0,01 |
| Andere Energieträger (Wärme) | GWh | 0,67 | 0,13 |
| Energieverbrauch Fuhrpark | GWh | 0,05 | 0,43 |
| Abfall | |||
| nicht gefährlich | t | 99,4 | 297,9 |
| gefährlich | t | 0,0 | - |
| Wasserwerk Billbrook1 | Wasserwerk Bergedorf | Wasserwerk Curslack | Wasserwerk Glinde | Wasserwerk Lohbrügge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billhorner Deich 2 20539 Hamburg |
Möörkenweg 45 21029 Hamburg |
Curslacker Heerweg 137 21039 Hamburg |
Papendieker Redder 79 21509 Glinde |
Krusestraße 8 21033 Hamburg |
||
| Mitarbeitende | Anzahl | 28 | 0 | 23 | 5 | 0 |
| Fläche des Standortes | m² | In Hauptverwaltung integriert | 8.422 | 237.813 | 126.816 | 13.026 |
| Bebaute Fläche | m² | In Hauptverwaltung integriert | 1.211 | 24.944 | 8.060 | 2.077 |
| Versiegelungsgrad | % | In Hauptverwaltung integriert | 14 | 10 | 6 | 16 |
| Wasserschutzgebiet | km² | 3,6 | WSG nicht erforderlich | 24,4 | 35,8 | WSG nicht erforderlich |
| Rohwasser-förderung | m³ | 8.910.010 | 1.797.978 | 20.277.086 | 6.682.050 | 1.211.392 |
| Reinwasserabgabe | m³ | 8.738.910 | 1.738.371 | 19.959.196 | 6.638.790 | 1.203.467 |
| Eigenverbrauch2 | m³ | 171.100 | 59.607 | 317.890 | 43.260 | 7.925 |
| Energie | ||||||
| Elektrische Energie | GWh | 8,54 | 0,97 | 4,47 | 2,90 | 0,54 |
| Andere Energieträger (Wärme) | GWh | 0,93 | 0,10 | 0,31 | 0,11 | - |
| Energieverbrauch Fuhrpark | GWh | 0,07 | - | 0,04 | 0,02 | - |
| Abfall | ||||||
| nicht gefährlich | t | 9,0 | - | 105,5 | 3,7 | 16,0 |
| gefährlich | t | - | - | 5,6 | - | - |
| Rückstände Wasseraufbereitung | t | 483,0 | 120,8 | 3.333,2 | 543,4 | 48,3 |
| Gefahrstoffe | ||||||
| Sauerstoff | t | 4,6 | 13,9 | - | - | 8,6 |
| Aluminat | t | - | - | 1,2 | - | - |
| Chlorgas | t | - | - | 5,7 | - | - |
| Natriumchlorit | t | - | - | - | - | - |
| Verfahrenstechn. Besonderheiten | - | Entsäuerung, Desinfektion | - | - | - |
| Wasserwerk Walddörfer | Wasserwerk Langenhorn | Wasserwerk Großhansdorf | Wasserwerk Großensee | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Streekweg 49 22359 Hamburg |
Tweeltenbek 12 22417 Hamburg |
Rümeland 41 22927 Großhansdorf |
Pfefferberg 30 22949 Großensee |
||
| Mitarbeitende | Anzahl | 11 | 5 | 6 | 7 |
| Fläche des Standortes | m² | 92.376 | 20.971 | 182.490 | 32.098 |
| Bebaute Fläche | m² | 18.686 | 5.230 | 9.353 | 6.475 |
| Versiegelungsgrad | % | 20 | 25 | 5 | 20 |
| Wasserschutzgebiet | km² | WSG nicht erforderlich | 10,6 | WSG nicht erforderlich | WSG nicht erforderlich |
| Rohwasser-förderung | m³ | 14.431.013 | 4.288.069 | 9.728.458 | 5.571.168 |
| Reinwasserabgabe | m³ | 14.354.029 | 4.235.778 | 9.680.233 | 5.498.636 |
| Eigenverbrauch1 | m³ | 76.984 | 52.291 | 48.225 | 72.532 |
| Energie | |||||
| Elektrische Energie | GWh | 6,10 | 2,14 | 2,73 | 2,44 |
| Andere Energieträger (Wärme) | GWh | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,05 |
| Energieverbrauch Fuhrpark | GWh | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Abfall | |||||
| nicht gefährlich | t | 16,6 | 6,0 | 2,1 | 12,3 |
| gefährlich | t | 4,1 | - | - | - |
| Rückstände Wasseraufbereitung | t | 664,1 | 205,3 | 700,4 | 174,3 |
| Gefahrstoffe | |||||
| Sauerstoff | t | 58,6 | - | 38,7 | - |
| Aluminat | t | - | - | 7,8 | 5,5 |
| Chlorgas | t | - | - | - | - |
| Natriumchlorit | t | - | - | - | - |
| Verfahrenstechn. Besonderheiten | Entsäuerung | Entsäuerung | - | Entsäuerung |
| Wasserwerk Bostelbek | Wasserwerk Neugraben | Wasserwerk Nordheide | Wasserwerk Süderelbmarsch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stader Straße 217 21075 Hamburg |
Falkenbergsweg 36 21149 Hamburg |
Fastweg 100 21271 Hanstedt |
Neuwiedenthaler Straße 169 21147 Hamburg |
||
| Mitarbeitende | Anzahl | 5 | 5 | 7 | 27 |
| Fläche des Standortes | m² | 41.533 | 104.183 | 184.223 | 56.084 |
| Bebaute Fläche | m² | 3.055 | 5.470 | 6.243 | 13.509 |
| Versiegelungsgrad | % | 7 | 5 | 3 | 24 |
| Wasserschutzgebiet | km² | 46,92 | 46,92 | Verfahren ruht bis Abschluss WR-verfahren | 46,92 |
| Rohwasser-förderung | m³ | 3.229.174 | 4.620.030 | 15.646.534 | 7.372.727 |
| Reinwasserabgabe | m³ | 3.077.107 | 4.618.808 | 15.736.624 | 7.482.080 |
| Eigenverbrauch1 | m³ | 152.067 | 1.222 | - 90.090 | - 109.353 |
| Energie | |||||
| Elektrische Energie | GWh | 1,99 | 1,92 | 5,78 | 7,62 |
| Andere Energieträger (Wärme) | GWh | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,30 |
| Energieverbrauch Fuhrpark | GWh | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
| Abfall | |||||
| nicht gefährlich | t | 53,6 | 19,2 | 4,7 | 217,2 |
| gefährlich | t | - | - | 3,0 | 7,6 |
| Rückstände Wasseraufbereitung | t | 157,0 | 229,4 | 446,8 | 3.189,9 |
| Gefahrstoffe | |||||
| Sauerstoff | t | 23,37 | 11,66 | - | - |
| Aluminat | t | 0,84 | 0,47 | 2,30 | 6,76 |
| Chlorgas | t | - | - | - | - |
| Natriumchlorit | t | - | - | - | - |
| Verfahrenstechn. Besonderheiten | Entsäuerung | Entsäuerung | Entsäuerung | - |
| Wasserwerk Baursberg | Wasserwerk Schnelsen | Wasserwerk Stellingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Kösterbergstraße 31 22587 Hamburg |
Wunderbrunnen 12 22457 Hamburg |
Niewisch 37 22527 Hamburg |
||
| Mitarbeitende | Anzahl | 10 | 2 | 10 |
| Fläche des Standortes | m² | 319.236 | 48.201 | 41.751 |
| Bebaute Fläche | m² | 12.413 | 4.386 | 11.130 |
| Versiegelungsgrad | % | 4 | 9 | 27 |
| Wasserschutzgebiet | km² | 10,0 | WSG nicht erforderlich | 8,62 |
| Rohwasser-förderung | m³ | 5.415.970 | 3.561.853 | 3.715.459 |
| Reinwasserabgabe | m³ | 5.053.900 | 4.435.617 | 2.806.193 |
| Eigenverbrauch1 | m³ | 362.070 | -873.764 | 909.266 |
| Energie | ||||
| Elektrische Energie | GWh | 2,72 | 1,82 | 1,49 |
| Andere Energieträger (Wärme) | GWh | 0,30 | 0,10 | 0,19 |
| Energieverbrauch Fuhrpark | GWh | 0,01 | - | 0,03 |
| Abfall | ||||
| nicht gefährlich | t | 5,40 | - | 39,90 |
| gefährlich | t | - | - | - |
| Rückstände Wasseraufbereitung | t | 314,0 | 265,7 | 495,1 |
| Gefahrstoffe | ||||
| Sauerstoff | t | - | 37,57 | - |
| Aluminat | t | - | - | - |
| Chlorgas | t | - | - | - |
| Natriumchlorit | t | - | - | - |
| Verfahrenstechn. Besonderheiten | - | - | - |
| Netzbetrieb Mitte | Netzbetrieb Süd | Netzbetrieb Nord4 | Netzbetrieb West | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohrnetz-bezirk Mitte | Sielbezirk Mitte | |||||
| Ausschläger Allee 175 20539 Hamburg |
Pinkertweg 3+5 22133 Hamburg |
Buxtehuder Str.52-54 21073 Hamburg |
Streekweg 63 22359 Hamburg |
Lederstraße 72 22525 Hamburg |
||
| Mitarbeitende | Anzahl | 60 | 1363 | 37 | 79 | 116 |
| Fläche des Standortes | m² | 36.577 | 34.809 | 4.568 | 11.372 | 14.480 |
| Bebaute Fläche | m² | 29.830 | 5.3602 | 1.307 | 1.140 | 6.311 |
| Versiegelungsgrad | % | 82 | 152 | 29 | 10 | 44 |
| Rohr-/ Sielnetzlänge | km | 1.637 | 1.836 | 1.6994 | 2.8655 | 3.3336 |
| Brauchwasser | m³ | - | - | - | - | - |
| Energie | ||||||
| Elektrische Energie | GWh | 0,21 | 0,41 | 0,01 | 0,08 | 0,39 |
| Andere Energieträger (Wärme) | GWh | 0,33 | 1,43 | 0,15 | 0,17 | 0,92 |
| Energieverbrauch Fuhrpark | GWh | 0,52 | 2,10 | 0,42 | 0,44 | 1,00 |
| Abfall | ||||||
| nicht gefährlich1 | t | 1.397,7 | 275,3 | 113,3 | 1.443,5 | 2.781,1 |
| gefährlich | t | 24,4 | 5,4 | - | 24,1 | 33,8 |
| Klärwerk Köhlbrandhöft & Abwasserlabor | Klärwerk Dradenau | Pumpwerk Hafenstraße | ||
|---|---|---|---|---|
| Köhlbranddeich 1 20457 Hamburg |
Dradenaustraße 8 21129 Hamburg |
Bei den St. Pauli Landungsbrücken 49 20359 Hamburg |
||
| Mitarbeitende | Anzahl | 285 | 12 | 4 |
| Fläche des Standortes | m² | 208.600 | 255.251 | 5.390 |
| Bebaute Fläche | m² | 65.236 | 100.392 | 2.537 |
| Versiegelungsgrad | % | 31 | 39 | 47 |
| Brauchwasser | m³ | 31.9271 | 8.513 | - |
| Trinkwasser | m³ | 56.718 | 2.119 | 194 |
| Kühlwasser | m³ | 395.835 | - | - |
| Energie | ||||
| Elektrische Energie | GWh | 91,25 | 10,70 | - |
| Andere Energieträger (Wärme) | GWh | 94,211 | 0,55 | 0,24 |
| Energieverbrauch Fuhrpark | GWh | 0,22 | - | - |
| Abfall | ||||
| nicht gefährlich | t | 391,7 | - | - |
| gefährlich | t | 20.479,1 | - | - |
| Rechengut | t | 4.800,0 | - | - |
| Abscheiderinhalte | t | - | - | - |
| Sandfangrückstände | t | 1.410,0 | - | - |
| Klärschlamm aus der Abwasserreinigung | t TS | 37.000,0 | - | - |
| Klärschlammmenge für Verbrennung | t TS | 52.714,0 | - | - |
| Gefahrstoffe | ||||
| Eisen(II)-sulfat | t | 7.788,0 | - | - |
| Flockungshilfsmittel | t | 1.100,0 | - | - |
HAMBURG WASSER
Postfach 261455, 20504 Hamburg
Barton, Kristina: Umweltmanagement
Häder, Ann-Christin: Umweltmanagement
Jonas, Ann Christin: Umweltmanagement
Schönecker, Astrid: Umweltmanagement
Meinhard Weidner, Art Director
Digital
Dr. Hans-Peter Wruk (DE-V-0051), EMAS-Umweltgutachter
Im Stook 12, 25421 Pinneberg
Geschäftsberichte HAMBURG WASSER
Umwelterklärungen HAMBURG WASSER ab 2007
Wasseranalysen der Wasserwerke von HAMBURG WASSER
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage oder unseren Social-Media-Kanälen:
| Name des Umweltgutachters | Regist rierungsnummer | Zugelassen für die Bereiche (NACE) |
|---|---|---|
| Dr.-Ing. Hans-Peter Wruk | DE-V-0051 | 36 Wasserversorgung 37 Abwasserentsorgung |
Mit Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass:
Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-Registrierung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erfolgen. Diese Erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit verwendet werden.
Pinneberg, den 4. Juli 2025
Dr. Hans-Peter Wruk DE-V-0051 |
||